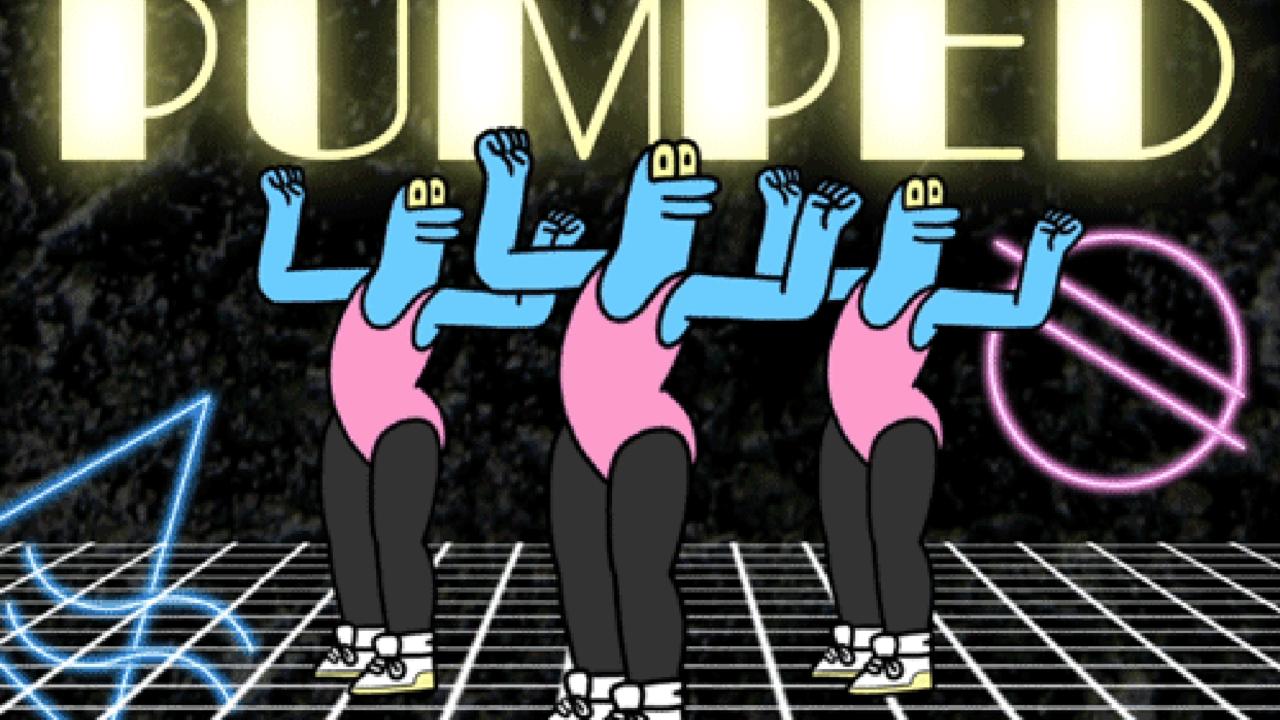„Ich bin weder Preacher noch Entertainer!“Interview: Nick Höppner über den Beruf Techno
8.6.2017 • Sounds – Interview: Thaddeus Herrmann
Alle Fotos: Katja Ruge
Wir müssen über Arbeit reden. Mit Nick Höppner, dem Resident der Berliner Panorama Bar. Nicht nur, weil sein neues, zweites Album so heißt – „Work“. Der Wahlberliner hat sich in den letzten vier Jahren neu erfunden und vollkommen auf das Auflegen und das Produzieren verlegt. Vollzeit-Stelle Techno. Das hat Konsequenzen, die Höppner fast schon sportlich annimmt. Der 44-Jährige fühlt sich wohl in seiner Rolle als DJ, weiß aber auch um die Verantwortung, die sich ganz automatisch ergibt, wenn man als nicht mehr junger Mensch den umso Jüngeren am Wochenende Musik vorspielt, in einem Business, das immer absurder und abstruser wird. Das Album – veröffentlicht nur zwei Jahre nach seinem Debüt „Folk“ – ist der bislang mit Abstand beste und reflektierteste Entwurf elektronischer Musik im Jahr 2017 und eigentlich gar kein Techno. Ein Gespräch über ökonomische Zwänge, Versprechen der Vergangenheit, die Realität der Gegenwart und eine unsichere, wenn auch berechenbare Zukunft.
Wenn du heute auflegst und aus der DJ-Kanzel auf den Dancefloor schaust: Was siehst du da?
Meine Kinder. Wer heute ausgeht, könnte in der Regel mein Kind sein, vielleicht sogar mein Enkel. Das ist mein Blick auf die Tanzfläche, sozusagen meine Beziehung mit dem Dancefloor. Das hat Auswirkungen. Wohlwollend, ein wenig beschützend vielleicht. Ich will schon, dass sie sich ausleben, will aber auch nicht, dass sie es übertreiben. Jeder soll und muss seine Erfahrungen machen, die Musik, meine Musik kann dabei aber eine Art schützenden Rahmen aufbauen, eine Art Anleitung sein von Menschen wie mir, älteren Leuten mit Erfahrung, die auch hinter den Kulissen gearbeitet haben.
Wie hat sich das, was du da siehst, in den vergangenen Jahren verändert?
Vornehmlich hat sich natürlich meine eigene Perspektive verändert. Da kann ich nicht aus meiner Haut. Meine Lebensumstände sind andere geworden und haben rein gar nichts mehr mit dem Club zu tun. Spürbar ist die Professionalisierung, die sich in den letzten zehn Jahren, vielleicht sogar 15 Jahren vollzogen hat. Einerseits parallel zum Berlin-Hype, aber auch gesellschaftliche Veränderungen spiegeln sich hier wider. Alles wird durchoptimiert und das strahlt auch auf einen selbst ab, weil man ja Teil einer solchen Nacht ist.
Erklär das bitte.
Ganz einfaches Beispiel: das Soundsystem. Das spielt heute eine ganz große Rolle, über das sich viel definiert. Vor 15 Jahren haben wir uns auch über schlechten Sound mokiert, Klang wurde aber nicht so fetischisiert. Aber es geht auch um das, was einem präsentiert wird. Wenn man früher ausging, konnte man an einem Abend zwei bis drei DJs hören. Wer heute im Berghain lang genug durchhält und zwischen den Floors wechselt, bekommt 14 DJs. Optimale Länge, optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ausgehen ist durchökonomisiert. Das Auflegen ist seit einigen Jahren meine einzige Einnahmequelle. Darauf habe ich hingearbeitet, es auch ein bisschen darauf angelegt. Wenn man sich aber anschaut, wie viele DJs es gibt, wie viele Clubs und Festivals und vor allem auch wie viele Menschen davon mittel- und unmittelbar davon leben können, einige sehr gut, andere mehr oder weniger prekär: Da hat sich schon sehr viel verändert.
„Es geht heute beim Ausgehen nicht mehr Alternativen, um die Selbstermächtigung.“
Inhaltlich habe ich den Eindruck – ich sage nochmal, dass das nur meine Perspektive ist –, dass es beim Ausgehen nicht mehr um Alternativen und um Selbstermächtigung geht. Das hat in meiner persönlichen Geschichte neben der Musik immer eine große Rolle gespielt. DIY. Räume finden, Räume besetzen, Dinge ausprobieren. Da stand das Geld überhaupt nicht im Vordergrund, es ging vielmehr darum, zu zeigen, dass es auch anders geht als „Dorfdisko“. Dass man auch anders miteinander umgehen kann. Dieser Ansatz ist ein bisschen verloren gegangen. Ein gutes Indiz dafür ist, dass vielerorts gerade sehr dafür gekämpft wird, sich diesen alten Habitus, gerade aus der queeren Perspektive, zurückzuerobern. Weil das Wirtschaftliche mittlerweile alles bestimmt. Nachtleben ist zwar auch in diesen Strukturen noch die große Eskapade, hat aber eine andere Funktion. Es geht nicht mehr um Utopien, sondern nur noch darum sicherzustellen, dass man am Montag im Büro nicht verrückt wird. Weil man am Wochenende genug Dampf ablassen konnte.
Erst Geld einwerfen und dann abfahren. Sind wir hier in Berlin in dieser Beziehung nicht deutlich länger verwöhnt worden, als anderswo? Das Nachtleben war doch meistens stark reglementiert und straff organisiert.
Weiß ich nicht. Ich selbst bin 2001 nach Berlin gekommen. Davor war ich neun Jahre lang in Hamburg. Natürlich gab es dort deutlich weniger Freiräume im Berliner Sinne, aber es gab sie. Ich denke da weniger geografisch, sondern viel mehr zeitlich. Auch in Hamburg war in den 90er-Jahren die Gentrifizierung noch nicht so weit fortgeschritten. Auch dort hat sich das kapitalistische Rad langsamer gedreht. Natürlich findet man das heute in Berlin noch vergleichsweise einfach. Dazu war das Leben hier in den 90er-Jahren einfach zu breit gefächert, diese Haltung hat sich in so viele Biografien eingeschrieben, dieser Geist lebt weiter. Wahrscheinlich findet man das sogar noch viel öfter und einfacher, als ich mir das vorstellen kann. Wenn ich nicht auflege, ist Ausgehen so ungefähr das letzte, das ich mir vorstellen kann. Mit wenigen Ausnahmen. Vielleicht lebt und blüht die Subkultur und ich weiß es einfach nicht.
Die Idee des Paralleluniversums.
Am Rande bekommt man das natürlich mit. Partyreihen, bestimmte Locations, wo nur auf Mundpropaganda gesetzt und sehr penibel darauf geachtet wird, dass im Internet keine Spuren hinterlassen werden.
Schlägt die optimierte Erwartungshaltung auch auf dich zurück?
Manchmal, klar. Aber das war eigentlich schon immer so. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Es gehört dazu, sich auf bestimmte Orte vorzubereiten und den richtigen Mittelweg zu finden. Ich bin kein Preacher, aber auch kein Entertainer. Und mittlerweile spiele ich auch keine Tracks mehr, von denen ich weiß, das sie funktionieren würden, ich sie aber nicht mag.

Dein neues Album „Work“ speist sich meinem Empfinden nach aus Erinnerungen und prägenden Momenten. Stimmt das so?
Es ist zumindest eine sehr persönliche Platte, ja. Ich habe mir die Freiheit genommen, morgens ohne konkrete Ziele ins Studio zu gehen. Die Erfahrung zeigt, dass immer, wenn ich mit dem Vorsatz „Clubtrack“ anfange, nur Grütze dabei rauskommt. Einen ordentlichen Clubtrack zu machen, halte ich ohnehin für das Schwierigste auf der Welt überhaupt. Das erfordert viel Zurückhaltung. Mit wenigen Mitteln eine große Wirkung zu erzielen, ist große Kunst. Das gelingt mir nie gewollt, wenn, dann eher zufällig. Das ist so, wie wenn der Angler darauf wartet, dass ein Fisch anbeißt. Die Platte hat schon Spuren von Dingen, die mich jenseits von Techno und House beeinflusst haben. Indie und Dub zum Beispiel. Das Album ist der Versuch, etwas Hybrides zu schaffen, ohne dabei in die Nähe von Crossover zu geraten. Das ist für mich eine wirklich schlimme Kulturtechnik.
Etwas Hybrides.
Ich meine damit, dass man nicht sofort hören kann, in welche Genre-Schubladen man Sound A und Sound B stecken könnte. Es ist nicht eindeutig und lässt sich so viel freier rezipieren und interpretieren. Also eben nicht: Hier ist Metal, da ist Rap.
Das wäre doch ein Projekt.
Ist mal wieder Zeit, stimmt.
Es gibt den Mythos, dass DJs nur produzieren, um Bookings zu bekommen. Denkst du Auflegen und Produzieren überhaupt zusammen?
Ich trenne das ziemlich strikt. Sonst würde meine eigene Musik auch ganz anders klingen. Ich mache Musik eigentlich nur für mich. Das ist eine Art Therapie. Ich empfinde es als zutiefst befriedigend, kreativ zu sein, auch wenn man sich dabei sehr disziplinieren und fleißig sein muss. Bei mir hat das mit Routinen zu tun. Ich muss jeden Tag ins Studio, am besten nine to five. Zu Hause sitzen, auf Inspiration warten und dann schnell ins Studio: Das funktioniert für mich nicht. Konstanz ist wichtig und dabei maximal ein lockeres Thema. Zum Beispiel: Heute bleibe ich unter 100 BPM. Konkreter wird es nicht.
„Ich bin DJ, ich brauche die Sichtbarkeit, ich bin auf Bookings angewiesen.“
Aber wann hast du konkret gespürt, dass sich die Regelmäßigkeit auszahlt? Auch diesen Schritt muss man ja erstmal gehen.
Ich will überhaupt nicht verneinen, dass das auch ökonomische Gründe hat. Ich bin DJ, ich brauche die Sichtbarkeit, ich bin auf Bookings angewiesen. Aber auch wenn ich dieses Spiel mitspielen muss, hat das Grenzen. Es gelten meine eigenen Bedingungen, sonst wird es unglaubwürdig. Da stehe ich mir vielleicht manchmal selbst im Weg, aber anders geht es nicht. Meine Präsenz in den sozialen Medien lässt bestimmt gemessen an heutigen Standards zu wünschen übrig. Ich will mir aber auch nicht blöd vorkommen.
„Bin ich nun Musiker oder nicht? Wenn ich einen richtig guten Pianisten höre, dann fühle ich mich überhaupt nicht so.“
Als ich vor viereinhalb Jahren beschloss, nicht mehr als Label Manager für „Ostgut Ton“ zu arbeiten, war klar, dass ich mich auf das Auflegen und Produzieren konzentrieren würde. Meine Kinder waren gerade ein halbes Jahr alt und irgendwo her musst das Geld ja kommen. Seinen Weg als DJ machen zu wollen, ist natürlich riskant, aber letztendlich das Schicksal eines jeden Freiberuflers. Stress und Unwegbarkeiten gehören dazu, wenn man nicht gerade zu der kleinen Gruppe der Superstars gehört. Und das Produzieren gehört schon irgendwie dazu. Ich habe aber schnell gemerkt, dass diese Rechnung so für mich in dieser Einfachheit nicht funktionieren würde. Dazu bedeutet mit die Zeit im Studio viel zu viel. Ich kann das nicht so pragmatisch betrachten. Dass mir Club-Tracks nicht leicht von der Hand gehen, hatte ich ja schon erwähnt. Ob ich nun Musiker bin oder nicht? Wenn ich einen richtig guten Pianisten höre, dann fühle ich mich überhaupt nicht so. Ich verspüre Ambition, stehe aber noch ganz am Anfang. Neulich erst habe ich mir einen Bass gekauft und übe jetzt. Ich will keine Band gründen, ich will das verstehen. Und lernen, wie ich das für mich einsetzen kann.
„Ich bin jetzt 44 und arbeite als DJ. Eigentlich Irrsinn.“
Gilt diese Unterscheidung für dich noch oder wieder? Der ausgebildete Pianist auf der einen und du auf der anderen Seite? Genau dagegen ist Techno doch mal angetreten.
Es ist natürlich vollkommen okay, das auch weiterhin so Punk-mäßig zu sehen und den Unterschied zwischen drei Akkorden und einer Fuge eben nicht zu machen. Aber: Eine bestimmte Art von Virtuosität haut mich einfach um, ich bewundere das. In einem Gitarren-Solo finde ich das immer noch scheiße. Joe Satriani oder Gary Moore. Aber ein toller Pianist beeindruckt mich wirklich tief. Das ist unfassbar. Außerirdisch. Da tue mich mir manchmal ein bisschen selber leid, dass ich mit 14 oder 15 nicht disziplinierter war, mich aber auch nicht durchgesetzt habe. Meine Mutter wollte, dass ich Saxophon spiele. Ich nicht. Ich wollte ein Schlagzeug, sie nicht. Damit war das Thema erledigt. Das ist schon ein Konflikt. Ich bin jetzt 44 und arbeite als DJ. Eigentlich Irrsinn. Andererseits funktioniert es aber auch und Erfahrung wird von vielen jüngeren Menschen geschätzt.
Mehr denn je.
Weiß ich nicht. Es massiert sich, würde ich sagen, weil das ganze Ding so wahnsinnig groß geworden ist und unsere Musik mittlerweile auch einfach eine Geschichte hat. Und bevor man sich den Kopf über die Zukunft zerbricht, schaut man lieber zurück. Deshalb spielt Retro weiterhin so eine große Rolle.
Richten wir uns in dieser musealen Gegenwart jetzt dauerhaft ein?
Ich denke schon. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich etwas Schlimmes ist. Junge Leute, die heute ins Berghain gehen, empfinden das ja ganz anders. Die sehen nicht das Museale, das der Club ja durchaus hat. Dass das von vornherein so angelegt war, ist dabei vollkommen egal. Wichtig ist: Als der Club eröffnete, waren die vier Jahre alt.

„Ich lege seit 16 Jahren auf, habe auch mal hinter Schreibtischen gesessen. Außer dem Abitur und meinen zwei Kindern habe ich aber eigentlich nichts vorzuweisen.“
Einige Protagonisten, die noch viel länger dabei sind als du, loten derzeit die Hochkultur als Sprungbrett aus.
Ich weiß, worauf du hinaus willst und natürlich kann man ihnen das vorwerfen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass man sich diese Fragen nach einer bestimmten Zeit einfach stellt: Wie geht es weiter. Ich lege seit 16 Jahren auf, habe auch mal hinter Schreibtischen gesessen. Außer dem Abitur und meinen zwei Kindern habe ich aber eigentlich nichts vorzuweisen. Und auch ich muss Kosten bedienen. Das ist bei den Superstars ja noch extremer. Die haben einen persönlichen Manager, einen Label-Manager, einen Tour-Manager und einen Remix-Manager: Die müssen alle bezahlt werden. Da kommen dann solche Sachen wie „Deutsche Grammophon Remixed“ bei raus. Und das ist genau der Crossover, den ich vorhin meinte. Das ist selten gut, ablehnen würde ich so ein Angebot aber wahrscheinlich auch nicht, wenn mir jemand das Vertrauen schenken würde. Das Rad dreht sich in diesem Geschäft so schnell, dass man da schon mal den Überblick verlieren kann. Erfolg, Erfolg, Erfolg: Da kann der kleinste Dämpfer schon zur Krise führen. Ich maße mir nicht an, eine Lösung parat zu haben. Ich kann verstehen, wenn solche Projekte zu Irritationen und Kritik führen, kenne aber eben auch die Innenperspektive.
Ob eine Platte oder ein Projekt gut wird oder nicht, liegt ja sowieso im Auge des Betrachters. Und es ist immer ein schmaler Grat.
Darüber habe ich mir bei „Work“ zum Beispiel gar keine Gedanken gemacht. Zwei Jahre nach dem ersten Album schon wieder eine LP zu machen, hatte ich gar nicht geplant. Dann füllte sich aber mein DJ-Kalender nur sehr sporadisch und ich dachte, ehe mir darüber jetzt noch mehr graue Haare wachsen und ich mir die dann ausreiße, versuche ich die Zeit lieber sinnvoll zu nutzen. Im Studio. Ohne Druck, ohne Erwartungshaltungen, die ich mir selber ausreden muss. Einfach machen. Und ich kann zum Ergebnis stehen. Ich finde die Platte sogar richtig gut, was mir sonst nicht so über die Lippen kommt.
Weitermachen.
Don’t cry. Work.

Nick Höppner, Work, erscheint am 9. Juni auf Ostgut Ton.