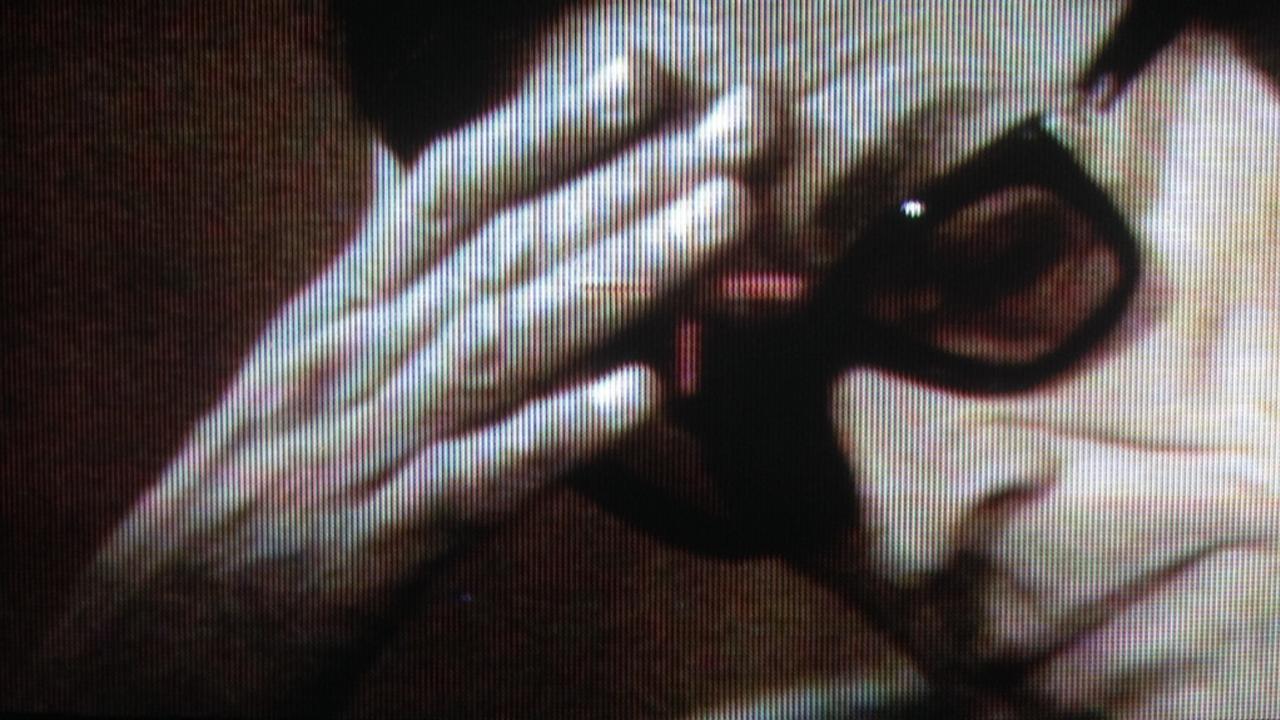Prisoner of Shark Island von John Ford lief in der Retro. Foto: Sammlung Österreichisches Filmmuseum
Das-Filter-Redakteur Sulgi Lie hat sich bei „Eitrigen“ und „Ottakringer“ auf der Viennale einige Filme angesehen. Aber nicht zu viele. Ein entspannter Bericht aus Wien.
##Eiter vor Schönheit
Österreichisch ist schon eine tolle Sprache: Da wird der in den Wiener Würstelbuden überall erhältliche „Käsekrainer“ in lokaler Mundart glatt die „Eitrige“ genannt. Jeder, der schon mal in so ein Ungetüm aus Fleisch und Käse gebissen hat, weiß, dass dieser liebevolle Kosename nicht treffender gewählt sein könnte. Die besten „Eitrigen“ gibt es in einem Würstelstand am Opernplatz, ganz in der Nähe des Österreichischen Filmmuseums, eine wunderbare Kinemathek und eine der Hauptspielstätten der Viennale. So freue ich mich bei meinem Wienbesuch fast ebenso sehr aufs Essen einer „Eitrigen“ (mit Gewürzgurken als Beilage) wie aufs Filmeschauen.

Hill of Freedom. Foto: Viennale
##Müder Meister
Super, dass gleich mein erster Festivaltag mit einem Film von Hong Sangsoo beginnt, einem meiner Lieblingsregisseure. Essen und Trinken, Fressen und Saufen sind absolute Essentials seines sowohl hochgradig durchkonstruierten als auch lässig einfachen Kinos, das der Festivalkatalog treffend als „komische Anthropologie“ des koreanischen Alltagslebens bezeichnet. Immer wieder hört man ja in letzter Zeit, wie die leistungsgepeinigten Koreaner alle am Rande des Burnouts stehen und sich in die totale Erschöpfung arbeiten – nur in Hongs Kino ist davon nichts zu sehen. Seine Filme sind der Gegenentwurf zum 24/7-Workflow-Regime, denn nirgendwo sonst wird mehr abgehangen, rumgelungert und unproduktiv Zeit vergeudet als in Hongs Kino der Faulheit. Schon der Titel seines neuen Films, „Hill of Freedom“ liest sich wie ein Lob des Müßiggangs: Da kommt ein leicht verpeilter Japaner nach Seoul, um eine alte Liebe wieder zu treffen, hängt aber meist ziemlich ziellos in einer kleinen Pension herum. Seine zufälligen Begegnungen mit Koreanern laufen stets etwas aus dem Ruder, was nicht nur an dem manifest kommunikationshemmenden Broken English liegt, sondern latent auch an den wohlbekannten nationalhistorischen Spannungen zwischen beiden Ländern. In typischer Hong-Manier ist die Erzählung durch achronologische Flashbacks zerfleddert; das Bild durch unmotivierte Zooms gestört; natürlich wird wieder extrem viel Soju gesoffen und in einer sehr lustigen Szene spricht ein Expat plötzlich perfektes Koreanisch. Aber leider neigt der Meister diesmal zu sehr zum Selbstzitat und reiht etwas lieblos einen Hong-Joke an den anderen. Hongs hochfrequentem Workflow entspringen ein bis zwei Filme pro Jahr, vielleicht sollte er mal eine kleine Pause einlegen. Sein Slacker-Protagonist macht es am Ende des Film exemplarisch vor: Völlig überfordert von all den Liebes- und Sprachverwirrungen und zudem noch total verkatert legt er sich einfach zu einem Nickerchen am Mittag ab.

National Gallery. Foto: Viennale
##Guck mal, Rembrandt, Rubens und Turner!
Richtig fit bin ich aber auch nicht mehr: Früher hab ich bei Filmfestivals auch mal vier oder fünf Filme am Tag gesehen, heuer bin nach zweien schon müde. Nach dem Hong schau ich mir noch den allseits gelobten und IS-aktuellen „Timbuktu“ von Abderrahmane Sissako an, in dem spaßfeindliche Islamisten ein Dorf in Mali terrorisieren. Der Film hat seine schönen Momente, die Totalen sind toll komponiert, ist mir insgesamt aber doch zu moralisch-arthousig. Irgendwie zu arthousig klingt auch der russische „Leviafan“, den ich am nächsten Morgen gucken wollte, deshalb verschlafe ich ihn guten Gewissens, um mich dann ausgeruht in den dreistündigen „National Gallery“ der amerikanischen Dokufilm-Ikone Frederick Wiseman zu setzen. Bei meinem ersten Viennale-Besuch 2001 gehörte Wisemans „Domestic Violence“ zu den ganz großen Momenten meines Aufenthalts, aber leider sind die Institutionenporträts des Meisters etwas zu altersmilde: Ganz ungebrochen setzt Wiseman Logistik und Infrastruktur des berühmten Londoner Museums in Szene. Dabei vermittelt sich zweifellos eine ganze Menge kunsthistorische und kunstvermittelnde Intelligenz. Man lernt interessante Details über die Tücken der Restaurationsarbeiten, kann sich aber nicht dem Eindruck erwehren, sich in einer etwas altbackenen, bildungsbürgerlichen Kunstunterweisung zu befinden: Guck mal, Rembrandt, Rubens und Turner sind schon groß! Da ist mir der frühe, roughe Wiseman der Psychatrien, Schlachthäuser und Beratungsstellen für geschlagene Frauen doch lieber als der gediegene Kunstkenner, der zu guter Letzt noch ein Ballett in den edlen Museumsräumen in Szene setzt. Nach soviel beflissenem Kunstsinn tun die „Ottakringer“ gut, die ich mir abends auf einer Party reinzische. Aber die Wiener Biere machen einen argen Schädel und so bin ich tags darauf zu fertig fürs Kino. Abends schleppe ich mich aber noch ins Filmmuseum und sehe zwei Filme aus der John Ford-Retro in erlesenen Kopien: den Überklassiker „The Searchers“ mit dem neurotischen Indianerhasser John Wayne und den frühen „Prisoner of Shark Island“, der mit expressionistisch ausgeleuchteter Gefängnis-Finsternis besticht. Vorher hab ich mir aber endlich eine „Eitrige“ gegönnt.

The Iron Ministry. Foto: Viennale
##Gewollt Arty
An Tag vier gehe ich in die Hommage für den kürzlich verstorbenen Harun Farocki und schaue mir „Nicht ohne Risiko“ (2004) an, der einen Venture-Capital-Deal zwischen zwei Firmen dokumentiert. Es ist schon „ur-gut“, wie der Wiener sagen würde, wie die sowohl biederen als auch abgezockten Business-Charaktermasken da nach und nach ihre ganze Schäbigkeit vor der Kamera performen. Eitrig, könnte man da auch sagen, nur dass sich die Businessmänner nach getanen Deals in einer bayerischen Kleinstadtpizzeria bei ein paar Bruschettas feiern.
Am Abend ist die Premiere von „Ein proletarisches Wintermärchen“, aber da der Regisseur des Films mein guter Freund Julian Radlmaier ist, verbietet sich an dieser Stelle eine Review. Vetternwirtschaft ist eitrig. Aber natürlich wird nach der Vorführung Schnitzel gegessen und wieder „Ottakringer“ getrunken, sodass ich am nächsten Tag abermals etwas angeschlagen bin. Da ist der hypermerkwürdige Experimentalfilm „Phantom Power“ des Franzosen Pierre Léon keine gute Wahl. Nach zehn Minuten prätentiösem, literarischen Voice-Over-Gefasel über Bildern von Pariser Altbauwohnungen verlasse ich mit meinem guten Freund Matthias Wittmann die Vorführung. Am Nachmittag kommen wir beide ins Metro-Kino zurück, um uns „The Iron Ministry“ von J.P. Sniadecki anzuschauen. Sniadecki ist Teil des gerade schwer angesagten Harvard Sensory Ethnography Lab, das sich ein somato-dokumentarisches Immersionskino zum Ziel gesetzt hat, bei dem einem Hören und Sehen vergehen soll. Eine entfesselte Go-Pro-Kamera taumelt da durch einen chinesischen Zug, dessen Inneres um einiges deliranter anmutet als die ICEs der Deutschen Bahn. Mein guter Freund Nikolaus Perneczky hat das alles super auf den Punkt gebracht. Matthias und mir hat’s auch gut gefallen, auch wenn ich die minutenlange industrielle Noise-Soundskulptur auf Schwarzbild am Anfang des Films etwas zu gewollt arty finde.

Mercuriales. Foto: Viennale
##Betrunkener Hipster
Ein Hipster-Film ist auch „Mercuriales“, ein verträumter Banlieu-Movie von Virgil Vernier. Nicht nur, weil Ober-Hipster James Ferraro den Soundtrack beigesteuert hat. In schick körnigen 16mm-Bildern gibt es statt Hong-Sangsoo-Männer-Müßiggang nun prekäres, weibliches Hang-Out. Ich muss gestehen, dass mich die Trash-Poesie des Films eher nervt, bleibe aber (auch wenn das jetzt eitrig klingt) wegen des Aussehens des serbischen Models Ana Neborac. Auch der Ferraro-Soundtrack ist schon ziemlich geil – manchmal klingt’s nach „Oneohtrix Point Never“ und in einem kurzen Moment nach dem Pop Ambient-Klassiker „Nicht die Welt“ von Ulf Lohmann, einem absoluten Lieblingstrack von mir und meinem guten Freund Jan-Peter Wulf. Jaja, die große Zeit von Köln Kompakt ist ja leider schon längst vorbei, wie ich kürzlich auch mit meinem guten Freund Christian Blumberg lamentiert habe: Was waren das noch für Zeiten, als die Kölner Schule noch mit mahlerianisch-wagnerianischen Ambient-Zauberbergen verzückte. Was mich jetzt von den wahnsinnigen Tristan-Akkorden von Hans Zimmer in „Interstellar“ schwärmen lässt, ein einziger Rausch, seinem „Inception“-Soundtrack mindestens ebenbürtig. Hier der Link zum Text meines guten Freundes Tim Schenkl. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Am letzten Abend in Wien esse ich zum Abschied betrunken auf dem Heimweg noch eine letzte „Eitrige“ an einem anderen Würstelstand, aber leider schmeckt sie nicht so gut wie die erste.