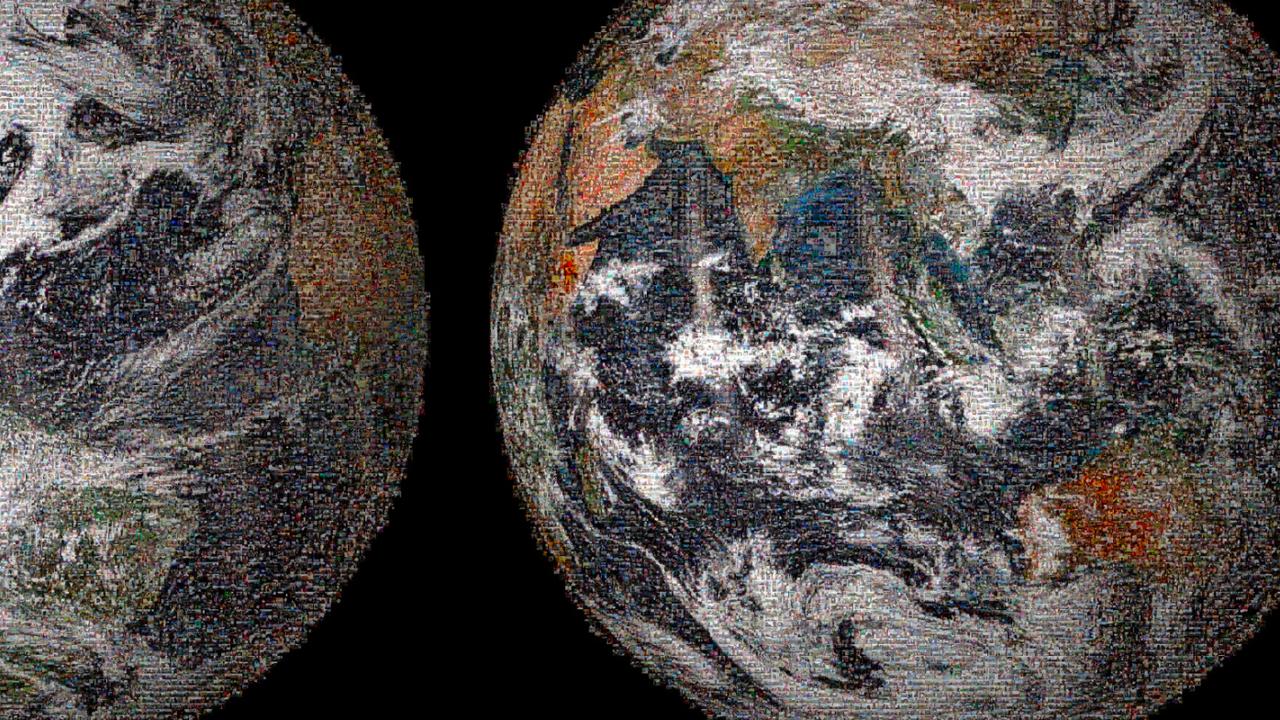Nachtprotokoll: Hilfssheriff wider WillenWenn dich die Berliner Polizei zwangsverpflichtet
29.5.2014 • Gesellschaft – Text: Thaddeus Herrmann
Eine Art Urinstinkt: Immer ausreichend Sicherheitsabstand zur Polizei wahren. Aber was passiert, wenn die Ordnungskräfte aus der Not heraus mitten in der Nacht auf einen zukommen und Hilfe brauchen?
Neulich erzählte Redaktionskollege Ji-Hun Kim, ihm habe ein Berliner Müllfahrer zugewunken. Der kann doch nicht mich meinen, doch die hektisch rudernden Arme galten tatsächlich ihm und seinem Begleiter. Ob sie mal schnell helfen könnten mit diesem großen Altpapier-Container. Der sei randvoll, erdeschwer und seit der Recycling-Dienstleister radikal Stellen abbaue, müsse er seine Tour durch Berlin-Kreuzberg alleine machen. Fahren, Tonnen aus den Höfen holen, zum Wagen zerren, auf die Hebebühne wuchten. Das Teil hier sei aber einfach zu schwer. Zu dritt ging es dann irgendwie. Der Müllfahrer fuhr von dannen, diesen Job wünscht man nicht seinem ärgsten Feind an den Hals.
Dass in der freien Wirtschaft alles immer effizienter werden muss und das auf dem Rücken der Beschäftigen ausgetragen wird, ist schlimm genug. Auch, dass die Ordnungs- und Rettungskräfte chronisch unterbesetzt sind, ist hinlänglich bekannt. Was das für Folgen haben kann, zeigte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einer Berliner Hauptstraße.
„Der will vielleicht türmen. Sie müssten ihn dann aufhalten.“
Zwei Filter-Kollegen und ich hatten ein paar Drinks genommen. Die beiden wollten noch weiter, ich nach Hause. Es regnet fürchterlich. Und vor der Kneipe, da ist dieses Schlagloch, tief wie die Ostsee. Während der Verabschiedung nähert sich ein Polizeiauto. Keine Wanne, eher so ein Minivan. Zwei Polizisten steigen aus, waten durch den Schlagloch-Ozean und machen die seitliche Schiebetür auf. Nun sehen wir das Innere des Wagens. Ein Gefangenentransporter, mit einer grell beleuchteten Einzelzelle. Sitzbank, Metallbeschläge, klaustrophobisch eng. Die beiden Polizisten schauen erst sich an und dann uns. Der eine, ein älterer Mann, schmales Gesicht, noch schmalere Brille, wendet sich uns zu, die wir da immer noch stehen und überlegen, ob wir jetzt links und rechts lang müssen. Ob wir mal schnell helfen könnten. Bitte? Und vor allem: wobei? Der andere Polizist steigt mittlerweile durch die Schiebetür ins Auto. Der Brillenträger hält ihn auf, löst den Halteriemen seines Waffenholsters und erklärt in unsere Richtung: „Wir haben hier einen Gefangenen drin und müssen ihm jetzt die Handfesseln lösen, das ist Vorschrift. Aber das ist ein Randalierer und wenn mein Kollege jetzt diese Tür aufschließt und ihm die Handschellen abnimmt, muckst der vielleicht und will türmen. Sie müssten den dann bitte aufhalten.“
Wir schauen uns an. Wie soll das denn bitte gehen. Wir haben alle Zeug unter den Armen. Regenschirme, Plattenpakete, Rucksäcke. „Wie soll das denn bitte gehen“, nochmal, nur laut. Wir wollen gehen. Sofort. Aber haben irgendwie Mitleid mit dem Polizisten, der uns leicht flehend anschaut, seine Hand an der Waffe. Und sind auch verdutzt über die plötzlich zu spürende Autorität, die in der Luft liegt. Ein Passant bleibt stehen. „Was habt ihr denn mit dem gemacht,“ fragt er uns. „Der könnte türmen, wir sollen Schmiere stehen und ihn aufhalten.“ „Bitte was?“ Der zweite Polizist schließt derweil die Autozelle auf, nimmt dem Insassen die Handschellen ab, setzt ihn hin und schließt wieder ab. Kein „Aufmucken“, das Ganze dauert ein paar Sekunden. „Versteh' ich nicht,“ sagt der Passant. „Was hat der denn gemacht?“ „Keine Ahnung, ist ja auch egal,“ sagen wir.
Der erste Uniformierte steckt seine Waffe weg, sichtlich erleichtert. Dreht sich zu uns um. Daumen hoch. „Danke, Jungs.“ Beide steigen ein und fahren weiter. Der Passant nickt uns zu: „Was ‘ne krasse Nummer. Schönen Abend euch noch.“