Pageturner – Februar 2023: zwanghaft hip, heftige Wirkungen, subtile GeisterLiteratur von Sally Rooney, Jill Bialosky und Jessica Au
1.2.2023 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Die Irin Sally Rooney reißt den Kipppunkt der Cleverness. Die New Yorkerin Jill Bialosky beschreibt ein Frauenleben im Bildungsbürgertum im Big Apple. Und Jessica Au wagt eine wundervoll-verregnete Herbstreise ins Herz der Melancholie. Die drei Buchrezensionen von Frank Eckert für den Februar 2023.
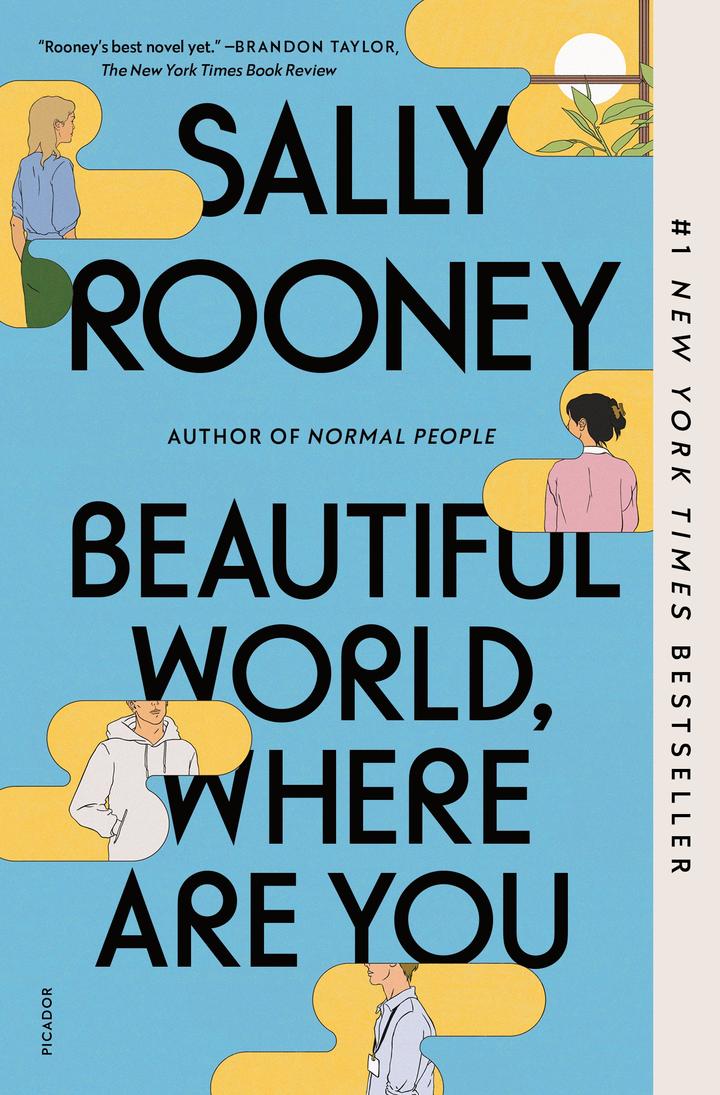
Beautiful World, Where Are You (Affiliate-Link) | Schöne Welt, wo bist du (Affiliate-Linki)
Sally Rooney – Beautiful World, Where Are You (Faber&Faber, 2021)
Über die avancierte Cleverness der megasellenden Konversationsromane der Irin Sally Rooney wurde schon so einiges geschrieben. Etwa über ihre Meisterschaft Figuren zu erschaffen, die ständig ihre sozialrevolutionäre Einstellung, ihr Klassenbewusstsein, ihre Modernität und ihre Bildung verbalisieren müssen, in Lebens- und Liebesdingen dann doch beachtlich traditionell und unemanzipiert agieren, ohne dass es heuchlerisch wirkt. Eher lebensnah-realistisch, manchmal sogar beinahe (aber nur beinahe) sympathisch. Dieser Effekt ist in Rooneys drittem und deutlich umfangreicheren Roman ebenfalls präsent, betitelt mit einem Zitat von Schiller, das den hohen Ton, der den Roman durchzieht, schon mal vorgibt. Der Roman ist eventuell sogar über den Kipppunkt hinaus clever, an dem aus einem Dialog ein Tischfeuerwerk intelligenter Pointen wird und ins Zwangs-Hippe und Altkluge umschlägt.
Interessant ist wiederum, wie explizit das Private abgehandelt wird. Was im Schlafzimmer und anderswo an kinky Sachen passiert, die in Rollenspielen und verschiedenen Macht- und Abhängigkeitskonstellationen bewusst un-woke ablaufen – als inverser Spiegel der lebensweltlichen Macht- und Abhängigkeitskonstellationen, der Reden von Privilegien, Klasse, Ausbeutung, Marxismus. Die vier Hauptfiguren fächern die Verhältnisse matrixförmig und symmetrisch auf.
Da ist die einsame Bestsellerautorin und der überschuldete Lagerarbeiter, die Redaktionsassistentin eines leidlich unerfolgreichen Literaturmagazins und ein katholischer Politikberater. Alle sind sich ihrer Privilegien, ihres sozioökonomischen und sexuellen Kapitals jederzeit mehr als bewusst und auf jeden Fall und grundsätzlich radikal links. Marxist:innen jener speziellen folgenlosen Art, die die Rede von der Alternativlosigkeit ihrer Eltern, etwas Thatchers TINA („There Is No Alternative“) nahtlos übernommen und so weit verinnerlicht haben, dass sie tatsächlich nicht mehr in der Lage sind, sich Alternativen zum Gegebenen vorstellen zu können, geschweige denn dafür dafür einstehen wollen. Ein gutes Konversationsthema, einen Aufreger bietet es aber allemal. Brandon Taylor hat diese Einstellung treffend als „learned helplessness“ bezeichnet.
Und die kann auf die Länge gehörig nerven, unglaublich massiv nerven sogar. Zynisch ist sie aber nicht. Die Figuren glauben fest, dass eine bessere Welt möglich ist (Kommunismus und so), und ebenso fest, dass sie selber definitiv nie die Möglichkeit bekommen werden dahin zu kommen. Also eine enervierende (vielleicht aber auch normale, übliche?) Mischung aus postpubertärem Fundamentalfatalismus und unsentimentalem Festhalten am Bestehenden bei maximalem Hedonismus? Irgendwie schon.
Dass das Buch dennoch auszuhalten ist, deutet auf Rooneys immense Kunstfertigkeit hin. Wenig an diesen Empatahie-armen, passiv-aggressiven klugen Menschen, die so viel wissen und können und es ständig thematisieren müssen und dabei nichts wollen, die nicht einmal den Willen aufbringen können, wirklich etwas zu wollen, lädt zur unmittelbaren Identifikation ein, oder wirkt sympathisch. Und doch stellt sich beides ein.
Der marxistische Kern liegt also vielleicht gar nicht im Klassenbewusstsein, der Politik oder anvisierten Revolution. Sondern mit Stalin in der dialektisch-inkludierenden Vorwegnahme jeder Kritik. Und der Wegnahme jedes Außen einer Ideologie: „Der dialektische Materialismus ist die Essenz seiner Kritik.“
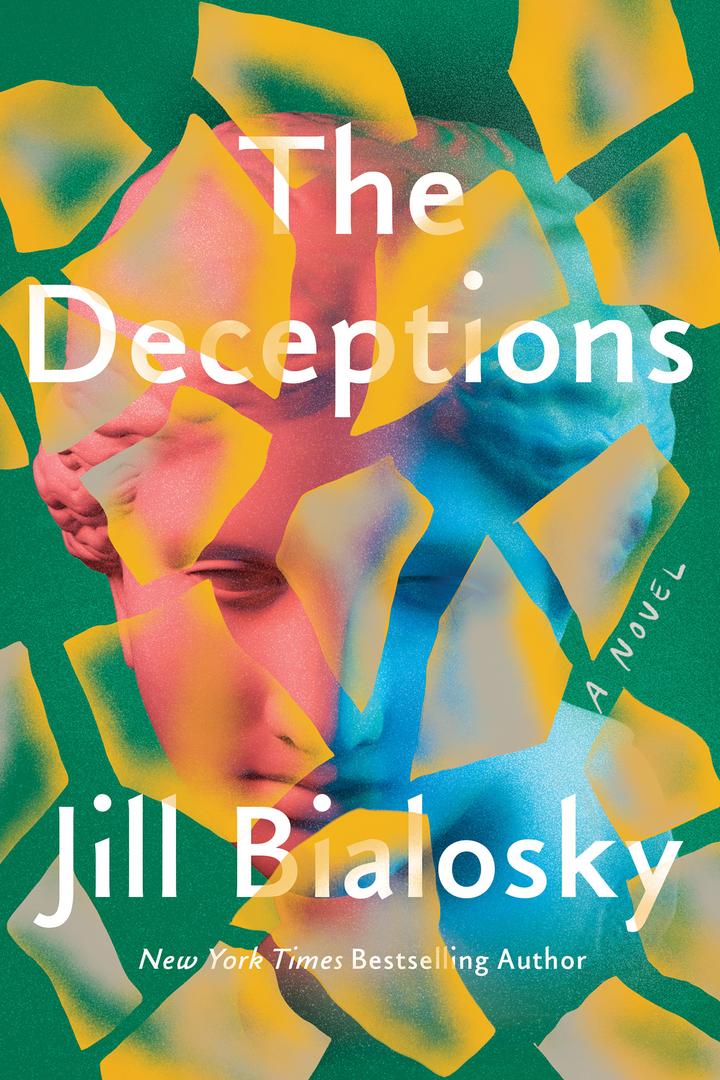
The Deceptions (Affiliate-Link)
Jill Bialosky – The Deceptions (Counterpoint, 2022)
Wie die Kunst das Leben retten oder zerstören kann – und uns alle: Das umschweift die New Yorker Lyrikerin Jill Bialosky in ihrem traumschwebenden Roman „The Deceptions“. Spezifischer: Wie die Künste, genauer moderne Poetik und klassische bildende Kunst vornehmlich skulpturaler Art, wie sie sich in der Antiken-Galerie des Metropolitan Museum of Arts in Manhattan findet, das Leben ihrer Erzählerin neu ordnen, neu sortieren, alte Ordnung auflösen, neues Chaos hinzugeben. So werden Tausende Jahre alte Statuen zu Gleichgesinnten oder Antagonisten. Und dann ist da die Erzählerin, die sich inmitten einer profan und schläfrig gewordenen Ehe nach dem Auszug des Sohnes und einer Freundschaft mit einem „Poet in Residence“, die in Verrat, Enttäuschung, Trauma und Trauma mündet, findet und ihren Alltag neu strukturieren muss. Eine Reise nach innen mit Gefährt:innen aus Marmor und Ton.
Dass Bialosky von der Poesie kommt, liest sich aus jedem wohlgesetzten Wort und jedem elegant konstruierten Satz dieses konzentrierten und nach WG-Sebald-Manier mit Bildern angereicherten Kurzromans. Die intensive Melancholie der Erinnerung hat ebenfalls etwas von Sebald, der feministische Blick eher nicht. Wobei das skulptural-indizierte Hölderlinsche Diktum „Du musst dein Leben ändern“ gar nicht unbedingt den Kern dieser Erzählung ausmacht. Es bestimmt eher einen Auslöser für das, was sein wird – aber immer daherkommend von dem was war.
Denn es geht um ein interessantes Frauenleben im gehobenen Bildungsbürgertum New Yorks (eine Szenerie, die aus so vielen Büchern und Filmen bekannt ist und doch immer sehr irreal, sehr weit weg bleibt vom hiesigen Wintergrau um eine innere Emanzipation), mit Wirkungen, heftigen Wirkungen nach innen (und weniger nach außen), die aber darauf beharren, nie zu vergessen, was du weißt, wo du herkommst, wie du zu dem wurdest was du bist. Und im Jetzt darauf bestehen genau zu sehen, wahrhaftig zu empfinden. Die Melancholie der Erzählerin ist – mit Cynthia Cruz gesagt – eine „Melancholy of Class“: eines Geistes, einer qua Herkunft und Klasse immer fremd bleibenden unter den besser gestellten Akademiker:innen und Pedigree-kultivierten Großbürgerkindern New Yorks.

Kalt genug für Schnee (Affiliate-Link)
Jessica Au – Kalt genug für Schnee (Suhrkamp, 2022)
Gen Fernost reisen, das macht man um etwas (wieder) zu finden: sich selbst, eine Beziehung, ein Leben, einen Sinn. Das gilt nicht nur für ausgebrannte Europäer:innen. Auch aus Hongkong reist eine Tochter mit ihrer Mutter nach Japan, um dort eine Kultur-Rundreise zu machen. Aber eben genauso, um die erkaltete Beziehung noch einmal neu zu beginnen. Soviel zu den allfälligen Klischees. Die in Australien lebende Autorin Jessica Au macht in ihrem erst zweiten Roman in zehn Jahren aus diesem banalen Setting eine ultrasubtile Geistergeschichte, die alles Drama, alles Melodram und alle Action, die üblicherweise einer solchen Road-Novel anhängen, beiseite lässt.
Die Mutter wirkt angesichts der (unglaublich schön und treffend beschriebenen) Kultur und Natur, der Städte und Events immer merkwürdig unbeteiligt und gleichgültig. Bis nicht mehr klar ist, ob diese psychische und emotionale Abwesenheit auch eine physische ist. Die Handlung bewegt sich entlang sattsam bekannter Touristen- und Kulturorte in Tokio, Osaka und Kyoto und schafft es, die in Reiseerzählungen üblichen Japan-Klischees weitgehend zu meiden.
Kein kleines Kunststück. Die kleine Novelle ist eine wundervoll verregnete Herbstreise ins Herz der Melancholie, in der jeder Satz und jeder Ton stimmt. Obwohl die Erzählerin doch so unzuverlässig ist. Aber genau das ist der Reiz, das ist die Kunst hier.





