Pageturner: Literatur im Mai 2019Reni Eddo-Lodge, Felwine Sarr und Tressie McMillan Cottom
6.5.2019 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Wer schreibt, der bleibt. Das gilt vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist unser Pageturner. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Im Mai geht es um große Themen unserer Zeit. Die Britin Reni Eddo-Lodge geht dem Rassismus auf den Grund – nicht nur in ihrer Heimat. Der Senegalese Felwine Sarr beschäftigt sich mit dem westlichen Universalitätsanspruch und destilliert daraus ein Plädoyer für ein neues afrikanisches Selbstverständnis. Und die US-Amerikanerin Tressie McMillan Cottom schaut aus ihrem afro-amerikanischen Blickwinkel auf den Stellenwert der Schönheit und den so entstehenden gesellschaftlichen Anpassungsdruck.
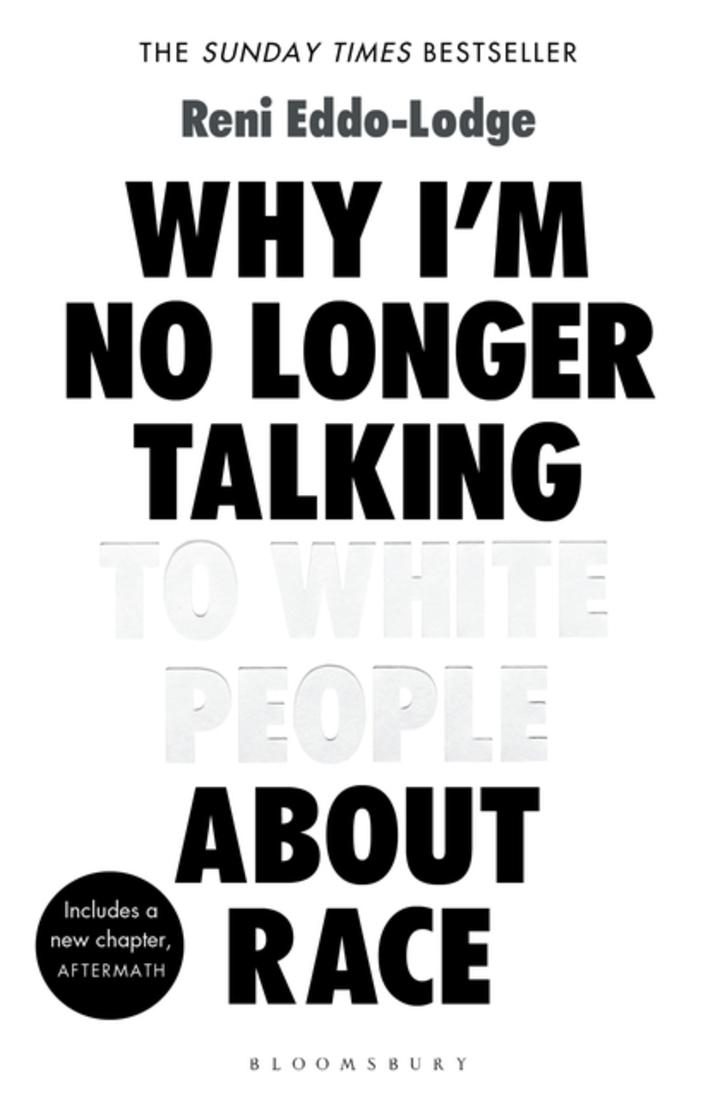
Why I'm No Longer Talking to White People About Race (Affiliate-Link) – Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche (Affiliate-Link)
Reni Eddo-Lodge - Why I'm No Longer Talking to White People About Race (Bloomsbury)
Die britische Journalistin Reni Eddo-Lodge, die unter anderem für den Guardian schreibt, hat sich 2014 in einem Blogeintrag die Frustration vom Leib geschrieben über die Ignoranz und das aneinander vorbei reden, die praktisch jede ihrer Diskussion über Rassismus und Privilegien dominiert und determiniert hat. Sie kommt (nicht zuletzt aus Selbstschutz) zu dem polemischen Schluss, dass es einfach nichts bringt, nicht möglich ist, mit der weißen Mehrheit über dieses Thema zu sprechen. Danach hat sie dann praktisch nichts mehr anderes gemacht. Das gleichnamige Buch ist der Versuch einer Erläuterung und Explikation des Themas. Es geht um schwarze Geschichte in Großbritannien, strukturellen und ganz „gewöhnlichen“ Rassismus, um Privilegien, Macht und Gewalt. Eddo-Lodges Definition von strukturellem Rassismus und „white privilege“ lässt sich sehr grob vielleicht so zusammenfassen: Vorurteile werden dann zu Rassismus, wenn sie aus einer Position der Macht heraus ausgeübt werden. Struktureller Rassismus ist die Summe der Vorurteile, Ängste und Abneigungen gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, die in Institutionen (Schule, Krankenhaus, Polizei) und sozialer Praxis dem alltäglichen menschlichen Umgang eingeschrieben sind – meist ohne dass die rassistischen Subjekte sich dessen bewusst sind. Privileg im allgemeinen und weißes Privileg im speziellen ist die ungehinderte (und oft unbewusste) Ausübung von strukturellem Rassismus. Dieser hat für die Priviligierten keine Konsequenzen, nur für die „anderen“. Wie der strukturelle Rassismus (und seine Eisbergspitze, der offene, vulgäre und gewalttätige Rassismus) im einzelnen und im Detail funktionieren und unterschwellig arbeiten, zeigt Eddo-Lodge an den Kaskaden vorwiegend britischer Beispiele von der Zeit des Sklavenhandels bis heute.
Das Frustrierende an dieser Diskussion ist für Lodge weniger der offene Widerstand, sondern die wohlmeinend ins Leere laufende Zustimmung der Priviligierten („don't give up on us!“) zu einem Problem, das nur sie, die Priviligierten, lösen können, sie aber selbst nicht betrifft und das sie im Normalfall nicht mal wahrnehmen. Ein Problem ist der strukturelle Rassismus für die, die man durch die Brille des Privilegs nicht sieht. So ist das Buch gegen den Titel ein ganz starkes Plädoyer für das Weiterdiskutieren und vor allem für die Weißen und Priviligierten geschrieben. Dass Eddo-Lodge dabei zwangsläufig polemisch vereinfacht und bestimmte Gruppen wie die britische Arbeiterklasse oder anglo-amerikanische weiße akademische Second- und Third-Wave- Feministinnen zu homogenen Entitäten zusammenfasst, ist für ihre Argumentation zwar nicht hilfreich aber zu verkraften. Ein starker wie (hoffentlich) unmissverständlicher Appell wider die Ignoranz und das Schweigen zu diesen Dingen ist das Buch allemal.

Afrrotopia (Affiliate-Link)
Felwine Sarr - Afrotopia (Matthes & Seitz)
In ihrer polemischen Analyse der öffentlichen Wahrnehmung nicht-weißer Positionen „Why I’m No Longer Talking to White People About Race“ beklagt Reni Eddo-Lodge vor allem die Unsichtbarkeit einheimischer Stimmen der in Europa oder den USA lebenden Nachfahren von Sklaven, Migranten aus kolonialen Zusammenhängen und Arbeitsmigranten im akademischen Diskurs wie in den populären Medien. Die junge Generation neuer panafrikanisch-globaler Denker*innen, die in Afrika geboren und oft in britischen, französischen oder US-amerikanischen Elite-Institutionen ausgebildet wurden, sieht Eddo-Lodge dagegen kritisch, von westlicher Akademia hofiert, aus ihrer Sicht geradezu gehypt. Wie der Kameruner Achille Mbembe hat der Senegalese Felwine Sarr von genau diesem Boom profitiert. Aber ist es wirklich ein Hype, wenn bisher ungehörte marginale Positionen näher ans Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden? Mindestens ist der Hype darin gerecht. Im Falle von Mbembe und Sarr haben so zwei originelle und kompromisslose Denker eine Chance bekommen, deren Ideen und Inhalte sich weder auf die westliche Philosophiegeschichte noch die gängigen postkolonialen Diskurse beschränkt. Sarrs „Afrotopia“ war in Frankreich sogar ein Theorie-Bestseller.
Die Polemik wider den westlichen Universalitätsanspruch und wider der Postmoderne bringt einiges auf den Punkt, was im üblichen hiesigen Diskussionen in Akademia und Medien schlicht unter den Tisch fällt. Der Startpunkt von Sarrs Überlegungen ist die sich langsam verfestigende Erkenntnis, dass westliche (europäisch-amerikanische) Modelle und Rezepte von Aufklärung und Entwicklung auf Afrika angewandt grandios gescheitert sind – dabei aber immer noch angewandt werden und immer noch scheitern. Was zudem das Elendsbild Afrikas eines von Hunger, Korruption und Gewalt, Misswirtschaft und autoritären Regimen geplagten Kontinents befördert. Das selbstbewusste, vor allem unter jüngeren wohlhabenden und im Westen ausgebildeten Afrikanner*innen verbreitete Gegenbild eines vor allem ökonomisch aufstrebenden globalen „neuen Afrikas“ ist nach Sarr aber ebenso falsch, weil es die Besonderheiten der afrikanischen Erfahrung ignoriert. Sarr sieht die Chance einer genuin afrikanischen Zukunft im Rückgriff auf die jeweils spezifischen lokalen spirituellen Erfahrungen, die noch nicht (wie im Westen) vollständig entzaubert und einer rein ökonomischen Rationalität unterworfen sind. Im Verhältnis der Afrikaner zur Natur sieht Sarr ein Potenzial, das im Westen lange verloren ist.
Die Rückbesinnung auf spirituelle Ressourcen und lokale Traditionen ist nicht anti-aufklärerisch oder esoterisch gedacht. Sarr versteht sie als Chance, an der Entwicklung der globalen Kultur aktiv mitzuwirken, sich nicht einfach an sie ranzuhängen, oder sich gar von ihr abzuschotten. Sarr verfolgt also keine Identitätspolitik, er denkt fundamental panafrikanisch und global. In der optimistischen Lesart ist es also gerade ausgerechnet Afrika, dass der Welt eine lebenswerte Zukunft offen hält – oder bereits die Gegenwart prägt: So ist z.B. die französische Sprache nur deswegen noch weltweit bedeutsam, weil sie in weiten Teilen Afrikas gesprochen und weiterentwickelt wird (z.B. im hiesigen HipHop). Das klingt alles ziemlich plausibel. Kultureller Wandel und gesellschaftliche Veränderung sind offene dynamische Prozesse. Es ist keineswegs ausgemacht wohin die massiven Umbrüche führen, denen sich viele afrikanische Staaten gerade ausgesetzt sehen. Durchaus eine Utopie also, ein Wunschbild einer besseren Welt, das nicht immer so sein mag wie sich der gewöhnliche Westler/Nördler das vorstellt. Aber was wenn Afrika wirklich einmal die Welt rettet? Eine Vorstellung mit der ich mich anfreunden kann.
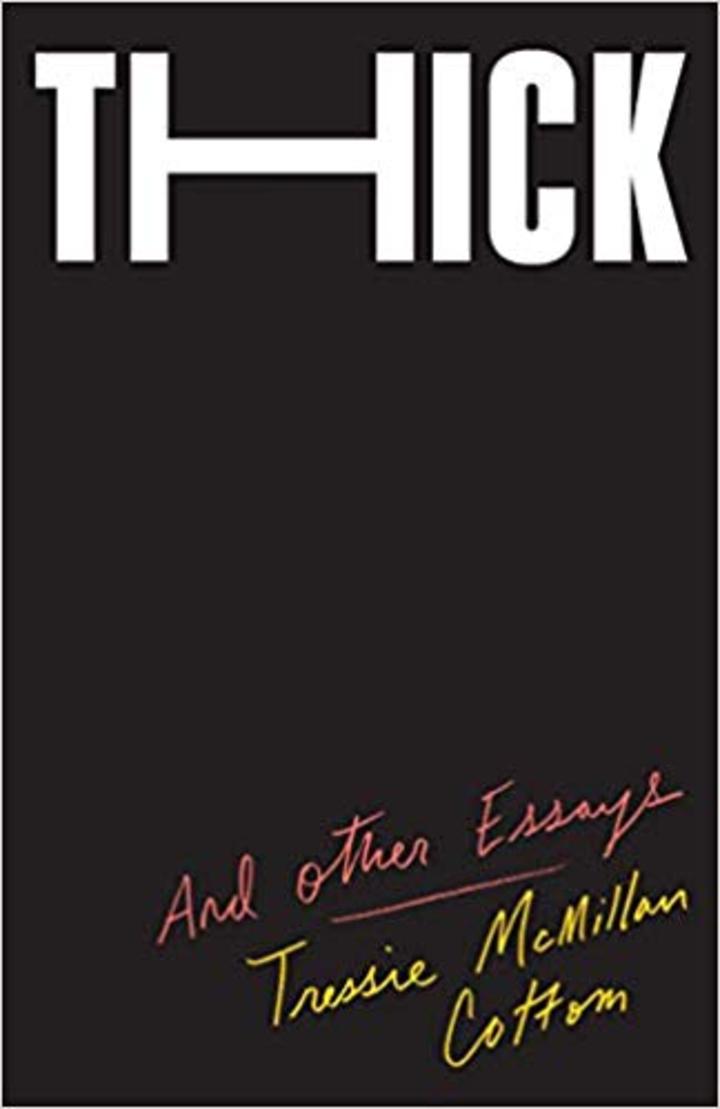
Thick (Affiliate-Link)
Tressie McMillan Cottom – Thick (The New Press)
Die US-amerikanische Soziologin und Intellektuelle Tressie McMillan Cottom hat sich gleichermaßen in der akademischen Welt wie in der Blogosphäre eine starke Position und einen guten Ruf erarbeitet. Sie wurde vor allem als Expertin und scharfe Kritikerin des (noch) vorwiegend auf die USA beschränkten Phänomens der „For-Profit“-Universitäten bekannt. Ihre Essay-Sammlung „Thick“ geht über diesen engeren Kontext allerdings deutlich hinaus. Die Texte sind eher feuilletonistisch, autobiografisch und literarisch. Sie mäandern durch so gut wie alle Aspekte afroamerikanischer Kultur und nicht-weißen, nicht-männlichen, nicht-straighten Lebens. Ein unterschwelliges Oberthema gibt es dann aber doch: Schönheit und der gesellschaftliche Anpassungsdruck, den sie verursacht. Wie Vorstellungen von Schönheit, Klasse, Weißheit (und Weisheit) ineinandergreifen und denen das Leben schwer machen, die es nicht schaffen in einer oder gleich mehreren der Subkategorien perfekt eingepasst zu sein – um vollständige Teilhabe einzufordern oder überhaupt erst einfordern zu wollen. Cottom ist natürlich zu reflektiert, um daraus folgenlos brotfürdieweltige „Wir sind doch alle schön“-Spruchweisheiten zu ziehen. Stattdessen versucht sie, die Bedingungen von Schönheit unter den heute gegebenen Realitäten genauer zu betrachten und in Frage zu stellen. Warum wurde Schönheit so wichtig? Wer profitiert davon? Worin liegen die unter den Tisch gekehrten Nebenwirkungen? Wie ganz ähnliche Mechanismen im Gesundheitssystem, der Arbeitswelt – gerade auch der akademischen – funktionieren: Das sind die Grundfragen, die sich durch die Essays ziehen.
Den tristen und wütend machenden Realitäten des schwarzen Amerika begegnet sie mit einem scharfen analytischen Blick und grimmigem Südstaaten-Humor, der keine Furcht hat, auch mal über sich selbst zu lachen. Das Panorama der niedrigschwelligen Kränkungen und systemimmanenten Verletzungen, die durchaus auch greifbar physisch sein können, wird aber nicht zur polemischen Anklage oder Klage. Cottom ist supersmart, engagiert und kann schreiben. Diese nicht nur im akademischen Feld rare Kombination macht diese Textsammlung zu einer kraftvollen wie schwungvollen App gegen Ignoranz, Bequemlichkeit und Verdrängung.





