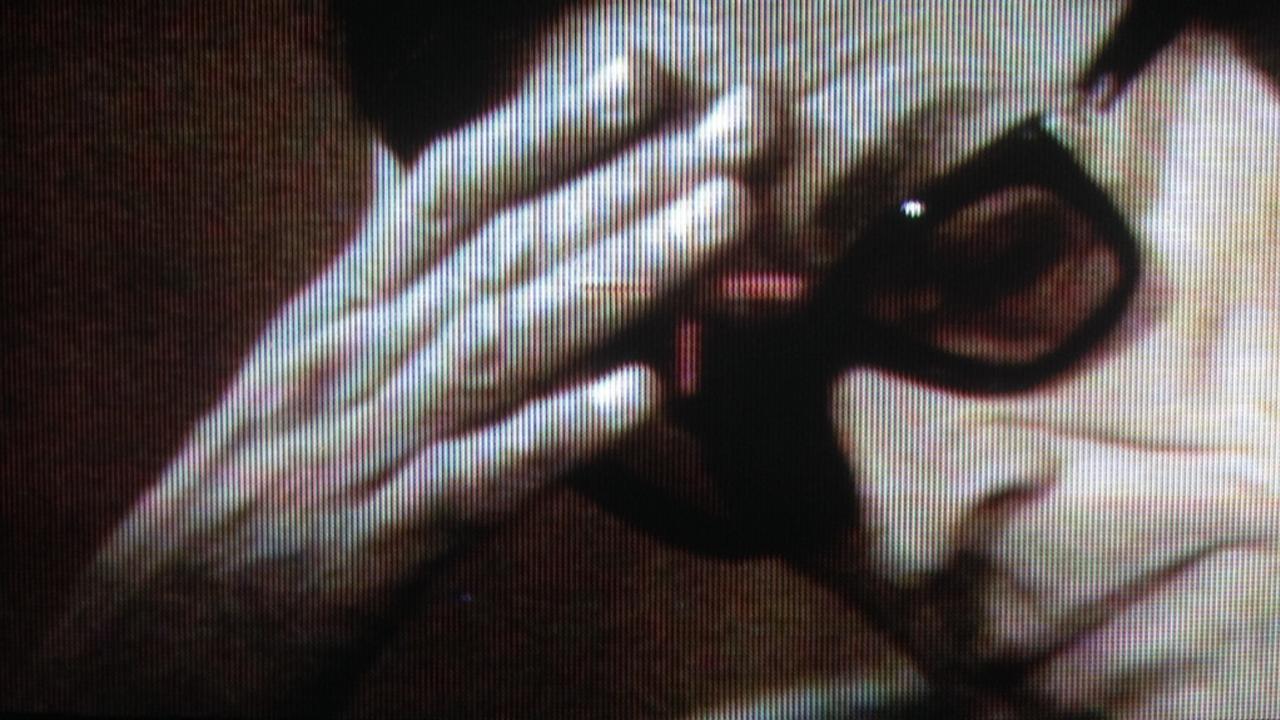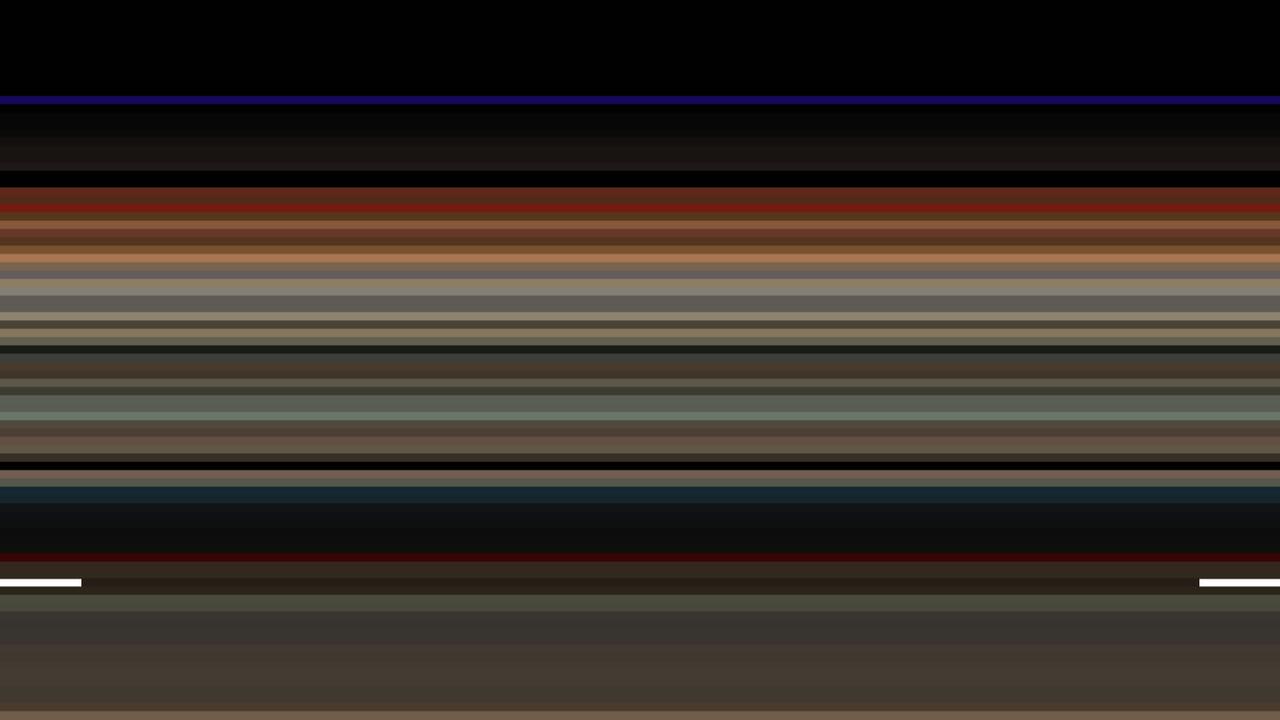David Cronenberg - Maps To The StarsPromis, Geister, Unterwelt
8.9.2014 • Film – Text: Christian Blumberg
Alle Bilder: Daniel McFadden
Mit „Maps To The Stars“, einem Genrezwitter aus satirischer Bespiegelung der Celebrity-Kultur und moderner Geistergeschichte, findet David Cronenberg zu alten Qualitäten zurück.
Cronenbergs letzter Film „Cosmopolis“ (2012) zeigte den Ex-Teenieschwarm Robert Pattinson (bekannt u.a. aus „Twilight“) als Finanzmogul, der fast ausschließlich in einer zum eigenen Kosmos überhöhten Stretchlimo durch New York cruiste. Auch in „Maps To The Stars“ begegnen wir einem adrett gekleideten Pattinson in einer Limousine – diesmal jedoch als Chauffeur. Sein erster Fahrgast ist die zuvor einem Nachtbus aus Florida entstiegene Agatha (Mia Wasikowska). Ausgestattet mit einem Exemplar der Map To The Stars, einem Wegweiser zu den Anwesen diverser Hollywood-Größen, wirkt Agatha zunächst wie eine Touristin, doch in Wahrheit ist sie der Teufel – dem in einem Film Cronenbergs natürlich alle Sympathien zufliegen. An dessen früheren Body-Horror erinnern auch die Brandmale, die Agatha seit ihrer Kindheit zeichnen. Da nämlich hatte sie das Haus ihrer schlafenden Familie in Brand gesetzt.
Das Attentat schlug fehl und nachdem Agatha jahrelang in eine psychiatrischen Klinik abgeschoben war, bedeutet ihre Rückkehr nach LA für ihre dort ansässige Familie nun eine drohende Katastrophe. Ihr Bruder Benji ist inzwischen ein heranwachsender TV-Star, der im Alter von dreizehn Jahren schon die erste Rehab hinter sich hat, seinen Fahrer öffentlich als „jewish faggott“ beschimpft und sich zugleich von der eigenen Mutter managen lässt, die wiederum mit dem Selbstoptimierungs-Guru Stafford Weiss (John Cusack) verheiratet ist. Der Autor pseudowissenschaftlicher Ratgeber und Host ein TV-Show namens „The Hour Of Power“ therapiert auch die alternde, von Erfolglosigkeit geplagte Schauspielerin Havanna Segrand (Julianne Moore), deren Mutterkomplexe er – in einer seltsamen Mischung aus Predigt und Massage – förmlich aus ihr herauszudrücken versucht. Cronenberg und die Konstellationen der Psychoanalyse: Das ist noch immer eine fruchtbare Verbindung.

Mia Wasikowska (links) und Julianne Moore (rechts)
Selten war ein Cronenberg-Film so pointiert und witzig geschrieben.
In diesem Setting geniert sich „Maps To the Stars“ zunächst wie ein weiteres Stück in einer Reihe Hollywood'scher Selbstdemontage. Die hat sich – mal leicht moralinsauer (wie in Sofia Coppolas „The Bling Ring“), mal in Form von Comedy (wie in Seth Rogens „This Is The End“) – in den letzten Jahren zu einem eigenen Genre entwickelt. Genau dort setzt „Maps To The Stars“ zunächst an. Selten war ein Cronenberg-Film so pointiert und witzig geschrieben. Die slicke Oberfläche des Films wird jedoch gestört, wenn Cronenberg sich genüsslich der darunter liegenden Hässlichkeit, dem Elend seiner Figuren widmet. Besonders Julianne Moore sticht hier hervor, die wirklich alles gibt, um ihrer Rolle und ihrem permanenten Zustand des Nervenzusammenbruchs die nötige Physis zu verleihen: Sie ächzt, sie kichert, sie tobt – das passt alles ganz hervorragend zu einer filmischen Abrechnung mit dem Starbetrieb. Cronenberg weiß aber, dass derartige Satiren zwar unterhaltsam, aber nicht gerade originell sind. Wie er auch weiß, dass diese Abrechnungen das Auratische, das sie zu zerlegen suchen, immer auch reproduzieren.
##Die Geister, die niemand rief
Cronenbergs Lösung dieser Problematik: Er lässt seinen Film immer wieder in den Modus der Geistergeschichte kippen. Mit Genrekino kennt er sich schließlich bestens aus. Und so wird Teen-Celebrity Benji plötzliche vom Geist eines todkranken Mädchens verfolgt, dem er während eines PR-Termins (Besuch eines Kinderhospizes) einst ein iPad geschenkt hat. Havanna Segrand wird derweil von der Erscheinung der eigenen Mutter heimgesucht, die vor ihrem Ableben eine weitaus erfolgreichere Schauspielerin als Havanna selbst gewesen ist, und welcher Havanna posthum – natürlich öffentlich, vermittels einer Talkshow – sexuellen Missbrauch vorwirft. Als Geistergeschichte interessiert sich „Maps to the Stars“ erfreulich wenig dafür, die Grenzen zwischen Einbildung und Realität auszuloten. Das Kippen ins Fantastische gebiert vielmehr ein mythisches Gebilde, ein Reich der Toten. Neben dieser aktualisierten Unterwelt existieren Cronenbergs Celebrities wie Halbgötter in einem inzestuösen System. Die Hollywood Hills geraten zu einem irdischen Olymp, der freilich nach allen Regeln zeitgemäßer Innenausstattung eingerichtet ist und sich inmitten kalifornischer Palmenpracht erstreckt, deren Üppigkeit geradezu obszön in Szene gesetzt ist. LA als Mythos zu zeigen mag im US-Kino zwar auch eine lange Tradition haben – doch der Ästhetizismus Cronenbergs entpuppt sich als geschickte Strategie. Denn die Künstlichkeit der offensiv ausgeleuchteten Kulissen verrät einen ästhetischen Überschuss, durch den die Charaktere, obwohl ihre Zeichnung einen Ankerwurf in die Realität darstellt, ihren Repräsentationscharakter für ein reales Milieu verlieren.
Durch seinen fast schon mythografischen Anspruch suspendiert sich dieser böse, kleine Film schließlich auch weitgehend von der Pflicht zum moralischen Urteil. Einzig in der Einstellung, in der Havanna Segrand schließlich mit dem eigenen Genie-Award erschlagen wird (der „kanadische Oscar“ – hier freilich ein Beweis ihres professionellen Scheiterns), – ein POV-Shot aus Sicht des Opfers – lässt, im Sinne eines Spiegels für die Zuschauer, deren tendenziell perverses Interesse Havannas bemitleidenswerte Existenz erst ermöglicht, eine unangenehm moralisierende Deutung zu. Das solche aber weitgehend unterlassen werden, schafft nicht nur Raum für eine Unmenge abstrus-komischer Szenen, sondern markiert auch Cronenbergs Rückkehr zu einer eigenen Stärke, zu einem Zeigemodus, der ihm zuletzt in der DeLillo-Verfilmung „Cosmopolis“ abhanden gekommen war.

David Cronenbergs „Maps To The Stars“ (USA, 2014), startet am 11. September in deutschen Kinos.