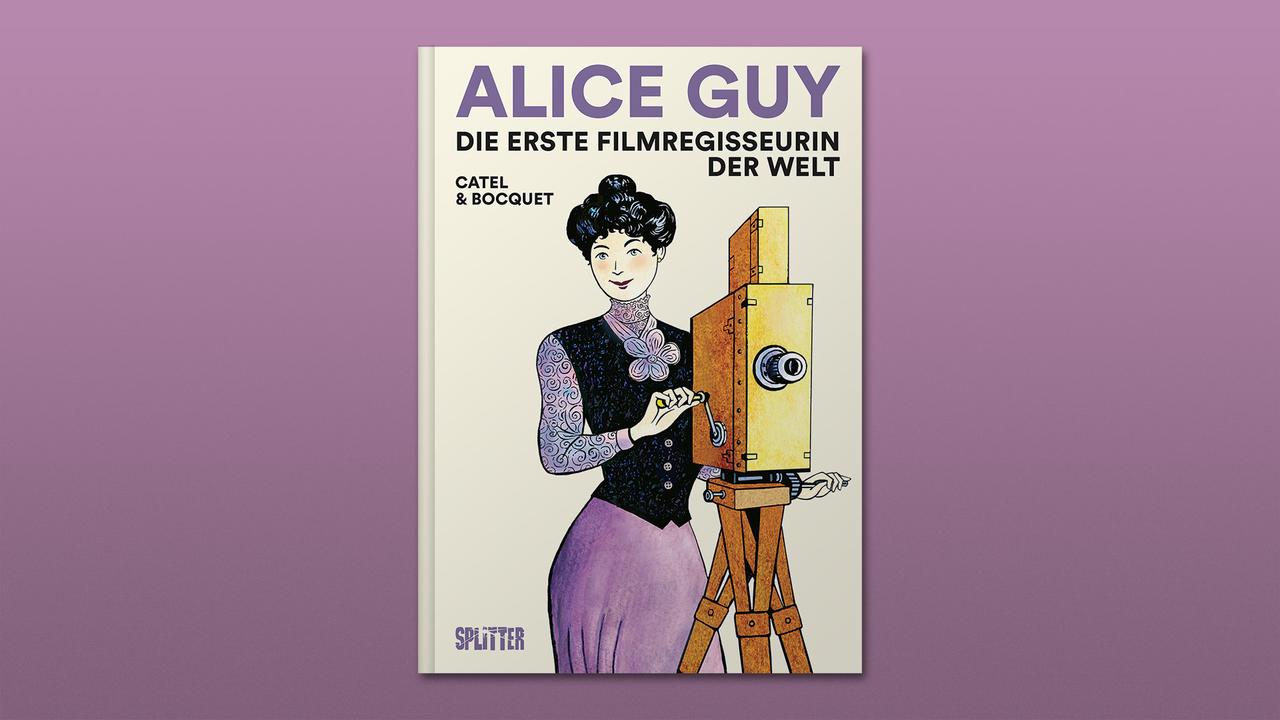„Das ist meine Firma, hätten Sie Interesse?”Interview mit Andreas Brandis, Managing Partner des deutschen Jazzlabels ACT
18.10.2023 • Sounds – Interview: Christoph Benkeser
Andreas Brandis. Alle Fotos: ACT
ACT. Das ist europäischer Jazz seit über 30 Jahren. 650 Veröffentlichungen sind auf dem Münchner Label erschienen – von Abba bis Avantgarde hat man sich als großer Namen neben ECM, dem Schickeria-Stadtrivalen, aufgebaut. Siggi Loch, Gründer von ACT und so etwas wie der Clive Davis des europäischen Jazz, hat zuletzt einen Generationenwechsel eingeleitet. Andreas Brandis ist mit 42 Jahren halb so alt wie Loch. Vor einigen Jahren übernahm der gelernte Indie-Mensch mit Major-Vergangenheit die Geschäfte. Zuletzt ist Brandis zum Partner des deutschen Jazzlabel aufgestiegen. Wieso das unter „Dickkopf Siggi” durchaus eine Überraschung war und warum sein eigener dicker Kopf den langjährigen Labelchef überzeugen konnte, erklärt Andreas Brandis im Interview. Außerdem sprechen wir über Sparring im Studio, das Alten-Bashing in Konzerthäusern und Perspektiven zwischen Tradition und Anarcho-Punk.
Andreas, du bist seit 2015 Geschäftsführer von ACT, seit letztem Jahr auch Partner und wirst das Label übernehmen. Wie hast du Siggi Loch kennengelernt?
Dazu gibt es eine schöne Geschichte. Ich war 2015 bei Universal respektive Deutsche Grammophon, kannte den Namen Siggi Loch also durch meine Tätigkeit. Wir hatten aber nie persönliche Berührungspunkte gehabt, bis mich eine E-Mail von ihm erreichte. Er wollte mich zum Essen treffen. Wir verabredeten uns. Seine Frau Sissy war auch dabei, als wir uns in Berlin-Grunewald im kleinen, aber legendären italienischen Restaurant Capriccio trafen. Nach ein, zwei Minuten Smalltalk sagte Siggi, ziemlich straight: „Passen Sie auf, ich bin auf der Suche nach jemandem, der ins Unternehmen kommt, es mit mir leitet und gegebenenfalls auch übernimmt.” Das war natürlich krass. Man kennt sich seit drei Minuten. Und dann sagt man zu dir: „Hier, das ist meine Firma. Ich habe keine Nachkommen. Hätten Sie Interesse?”
Wie hast du geantwortet?
Zuerst meinte Siggi, ich solle mit meiner Frau darüber sprechen, dann könnten wir uns weiter unterhalten. Meine Frau stand aber vor der Geburt unseres zweiten Kindes. Außerdem lebten wir in Berlin. Der Firmenhauptsitz von ACT befand sich derweil in München. Wir wussten also, dass ich pendeln müsste, gerade in der Anfangszeit. Meine Frau redete mir dennoch zu. Ich überlegte dann einige Monate, schlussendlich sagte ich zu – aus Überzeugung. Am Pfingstmontag 2015 sollte ich den Vertrag unterschreiben. Um vier Uhr früh schickte ich Siggi aus dem Kreißsaal eine SMS – das Kind kommt. Einige Tage später unterschrieb ich doch. Erst danach informierte ich Universal, weil ich die Entscheidung unabhängig davon treffen wollte, ob sie mir noch ein Gegenangebot unterbreiten.
„Bei einem Major gibt es Spezialist:innen für jedes Thema. Im Indie-Business muss man in allen Bereichen selbst anpacken.“
Universal war ein Major mit Hunderten Mitarbeiter:innen. Bei ACT arbeiten laut Firmenhomepage sieben Menschen. Ein großer Unterschied?
Total. Ich hatte aber schon Indie-Erfahrung, weil ich auch Schlagzeuger und über zehn Jahre künstlerisch aktiv gewesen bin. In die Label-Branche stieg ich erst 2008 über Ferryhouse Productions von Frank Otto ein. Björn Mathes, der Geschäftsführer des Labels, war mein erster Mentor. Später wechselte ich zu Universal. Der Unterschied zwischen Major und Indie war natürlich immens. Bei einem Majorlabel gibt es Spezialist:innen für jedes Thema. Im Indie-Business muss man in allen Bereichen selbst anpacken. Dadurch werden Entscheidungen unkomplizierter getroffen. Ein Tanker wie Universal bewegt sich langsamer als ein vergleichsweise kleines Indielabel wie ACT. Als Geschäftsführer verantworte ich nicht nur die musikalischen Entscheidungen, sondern auch das Budget, rechtliche Verpflichtungen oder die Mitarbeiter:innenführung in einem eingegroovten Team. Dahingehend war die Arbeit beim Major eine gute Schule für Fingerspitzengefühl in Interessenvertretungen.
Zu ACT bist du 2015 gekommen.
Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten manche Mitarbeiter:innen schon viele Jahre für das Label. Sie waren es gewohnt, dass Siggi das Zentrum war. Plötzlich wird ihnen ein junger Neuer vorgesetzt. Außerdem standen die Wetten gegen uns, denn: Siggi ist wie Manfred Eicher von ECM für seinen starken Charakter bekannt. Viele in der Branche glaubten, dass so eine dominante Persönlichkeit nicht loslassen könnte. Dass es doch möglich ist, war eine Herausforderung – aber auch meine Sorge. Schließlich war die Position bei Universal safe. Bei ACT musste ich mich erstmal mit meinen Qualitäten durchsetzen.
Qualität, das ist so ein Begriff. Was umfasst er?
Die Erwartungshaltung war vermutlich, dass mit mir der junge Innovator kommt, um ACT in die Zukunft zu führen. Ich habe mich hingegen entschieden, erstmal drei Monate zuzuhören und die Strukturen zu röntgen. Ich habe also keinen Aktionismus betrieben, bei dem man verändert, nur um etwas zu verändern. Ich wusste gleichzeitig, dass ein Firmenpatron wie Siggi keinen Ja-Sager holt, der ihn für seine Vergangenheit lobt. Ich habe mit ihm deshalb immer über Aktuelles gesprochen und Gegenpositionen eingenommen. Wir haben beide einen dicken Kopf und wir haben uns beide auch gerieben.

Siggi Loch
Was unterscheidet euch?
Siggi war sein ganzes Leben lang Chef. Er war nicht berühmt dafür, dass er sich durch seine Personalführung ausgezeichnet hat. Das weiß er. Das wurde besser. Ich war hingegen immer Team-Mensch, der Fokus liegt bei mir auf Zusammenhalt. Siggi hat es beeindruckt, dass ich schnell ein funktionales Team bilden konnte, das Bock darauf hat, neue Schritte zu gehen. Ich konnte aber auch von ihm lernen – vor allem eine gesunde Härte in notwendigen Entscheidungen. Außerdem verbindet uns der Hang zum Perfektionismus und die Liebe zur Vielfalt von Musik. Das war die Basis, das Vertrauen kam über die Arbeit. Dass ich keinen Unsinn mit seiner Firma mache, wurde ihm klar, als wir zum 25-jährigen Jubiläum von ACT große Konzerte ohne Live-Partner umsetzen konnten. Er war dabei nicht involviert, erkannte aber an, dass wir als Team gut arbeiten. Danach hat er angefangen, spürbar loszulassen.
„Wir wollen ein produzierendes Label bleiben. ACT war nie nur eine Serviceplattform, die Musik vertreibt.“
Das hört sich nach einem gesunden Generationenwechsel an.
Ja, wir begannen, Künstlerthemen und neue Signings gemeinsam zu entscheiden. Heute sitze ich vermehrt auch im Studio und produziere. ACT ist schließlich ein Unternehmen, das stark auf zwischenmenschlichen Beziehungen beruht. Für Siggi sind die Künstler:innen des Labels wie eine erweiterte Familie. Einer seiner engsten Beziehungen, jener zu Michael Wollny, ist heute eine meiner engsten Künstler:innen-Beziehungen. Das hat wiederum die Beziehungen zwischen den beiden verändert. Es ist emotional sicher schwierig, die Künstler:innen gehen zu lassen und zuzusehen, wie jemand anderes eine neue Beziehung aufbaut, zeigt aber auch, wie großzügig Siggi ist.
Du hast schon deine Arbeit als Produzent erwähnt. Wie bringst du dich in dieser Rolle ein?
Das hängt stark von den Künstler:innen ab. Ich war gerade mit unseren Granden – Nils Landgren, Wolfgang Haffner, Michael Wollny und Lars Danielsson – im Studio. Das Produzieren bei uns unterscheidet sich aber stark vom Pop-Bereich, wo der Produzent viel eher handgreiflich in die Musik eingreift. Ich vergleiche unsere Arbeit stärker mit dem Buchverlagswesen. Wir sind Sparringspartner und fragen permanent: Was macht ein gutes Album aus? Wenn man sich diese Frage stellt, muss man sich auch einer berechtigten zweiten stellen: Braucht es überhaupt noch Alben? Sofern man diese Frage mit ja beantwortet, müssen Alben Geschichten erzählen, denen man als Zuhörer:in folgen will. Deshalb arbeiten wir stärker konzeptionell als früher. Das heißt: Wir sprechen mit den Künstler:innen schon im Vorfeld der Aufnahmen über die Musik, um eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Im Studio nehme ich eine äußere Perspektive ein und kann sagen, ob ein Take eine gewisse Magie hat oder nicht. Früher war das Siggis Terrain. Inzwischen bringe ich mich immer mehr ein, weil: Wir wollen ein produzierendes Label bleiben. Schließlich war ACT nie nur eine Serviceplattform, die Musik vertreibt.
Das produzierende Element ist so etwas wie die ACT-Identität, oder?
Ja, unsere Daseinsberechtigung als Label leitet sich daraus ab, dass wir für Künstler:innen einen Mehrwert zum künstlerischen Schaffen hinzugeben können. Das ist nicht nur Marketing und PR, sondern die glaubhafte Darstellung der eigenen Kunst. Das ist in Europa nicht selbstverständlich. Neben ECM ist ACT eines der wenigen letzten produzierenden Labels im Jazz. Dieses Alleinstellungsmerkmal wollen wir weiterhin finanzieren. Deshalb war es für Siggi und mich wichtig, die Wertschöpfungskette zu erweitern, indem wir ins Live-Geschäft einsteigen – auch weil durch die Tonträgerverkäufe keine Refinanzierung unserer Arbeit mehr möglich ist.
Welchen Impact hat Streaming bei einem Label wie ACT?
Ein Künstler wie Joel Lyssarides kam zu uns mit fast zwei Millionen monatlichen Hörer:innen. Er ist ökonomisch viel erfolgreicher im digitalen Raum als im physischen. Selbst unsere arrivierten Künstler wie Michael Wollny müssen sich auf den Plattformen nicht verstecken. Wir zeigen also, dass es geht. Auch mit reiner Instrumentalmusik kann man Relevanz aufbauen. Aktuell kommt unser Umsatz noch zu 60 Prozent aus physischen Verkäufen und 40 Prozent über digitale Angebote. Zukünftig wird sich das ausgeglichen einpendeln, auch weil der digitale Bereich jedes Jahr zweistellig wächst. Dennoch werden wir immer Tonträger machen, weil es eine physische Zielgruppe gibt und wir sie bedienen wollen.

Aktuelle Künstler:innen bei ACT

Michael Wollny

KUU!

Emma Rawicz

Peter Somuah

Zielgruppe ist ein gutes Stichwort. Wie führt ACT ein junges Publikum an Jazz heran?
Von einem Major kommend habe ich mich immer dagegen gewehrt, dass Jazz Nische sein muss. Für den Jazz muss man sich nur aktuelle Strömungen ansehen, zum Beispiel die British Jazz Explosion, aber auch solche aus den USA, die viel mehr als nur Jazz umfassen. Wir gehen immer wieder Kooperationen mit Theo Croker, einem schwarzen Trompeter, ein. Er feiert die afroamerikanische Kultur von HipHop über Jazz, aber auch Fashion, Design und Kunst. Dieser Genre-Mix erreicht ein breites Publikum, das die Musik gar nicht mehr als Jazz bezeichnen würde.
Wo positioniert sich ACT in diesem Mix?
ACT stand immer für eine Bandbreite – von anspruchsvollem Avantgarde-Jazz bis hin zu dem, was manche kommerziell nennen. Dass es sich dabei nicht um seichte Musik handeln muss, zeigen wir auch, weil: Jazz kann von der Tradition bis zur Indie-Musik alles sein. Ein schönes Beispiel dafür sind Dearest Sister aus Schweden. Man könnte sie durchaus im Indie-Pop verorten. Auch bei einer Band wie Kuu!, die eine anarchische Version von Rock, Punk und Jazz machen, merkt man, wie unterschiedliche Publika sie erreichen. Darum geht es doch!
Alle zu erreichen?
Ich war kürzlich bei einer Sommerakademie in der Nähe von Fehmarn, wo wir viel über zukünftige Zielgruppen in der Klassik gesprochen. Ich merke: Die Konzerthäuser wollen jüngere Generationen erreichen, es herrscht ein Alten-Bashing. Darauf steige ich aber nicht ein, weil ich meine: Seid froh, dass eure treuen Hörer:innen noch kommen! Die Jungen werden immer für einen Moment bei einer Sache bleiben und dann weiterziehen, weil schon das nächste Neue kommt. Leute mit einem gefestigten Musikgeschmack folgen dir viel länger.
Und die Jungen werden auch irgendwann alt sein.
So ist es. Wenn jemand 45 ist, kann diese Person locker 30 Jahre zu deinen Konzerten kommen. Das heißt nicht, dass wir nur ältere Menschen ansprechen wollen, im Gegenteil: Wir versuchen, alle mit unterschiedlicher Musik zu erreichen. Das wirkt sich auch auf das Signing neuer Künstler:innen aus. Zum Beispiel Emma Rawicz, eine 21-jährige Saxophonistin aus dem UK. Sie spielt derzeit bei allen großen Jazz-Festivals. Oder Peter Somuah aus Ghana, der seine Version von Afrobeat macht und mit den Jungs von Sons of Kemet befreundet ist. Diese Vielfalt auf ACT hängt nicht nur mit Siggis Liebe zur Vielfalt von Jazz zusammen, sie ist auch mein Background.
Apropos Background. Wie Siggi zum Jazz kam, ist bekannt. Wie war das bei dir?
Ich bin in einer Familie groß geworden, in der klassische Musik eine große Rolle gespielt hat. Mein Vater war ein sehr guter Amateur-Cellist, sein Bruder war jahrelang Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Ich fing mit Geige an, wollte aber immer zum Schlagzeug. Das musste ich mir hart erarbeiten. Mit 14 bekam ich endlich Unterricht. Für meinen Lehrer waren Drums verbunden mit dem Jazz-Kontext. Dann brachte mir mein Bruder von einer USA-Reise eine CD von Elvin Jones mit. Dazu wurde ich in unserem Landkreis Teil einer Auswahl-Big-Band, bei der wir viel mit Peter Herbolzheimer gearbeitet haben. Parallel dazu lernte ich zwar Orchester-Schlagwerk, aber ich wusste schon: Die Klassik wird es nicht, sondern das freie Tun. Labels wie ECM und ACT haben mich dann beim Erwachsenwerden begleitet.
Und was ließ dich die Seiten wechseln?
Ich hatte nie den Plan, im Recording-Bereich zu arbeiten. Nach dem Musikstudium habe ich zwar meinen Master in Kulturmanagement gemacht, aber um ein zweites Standbein zu haben. Schließlich war es für mich keine Option, an einer Musikschule zu unterrichten. Durch Zufall bin ich über einen Werkstudentenjob bei Frank Otto und seinem Label Ferryhouse gelandet. Von dort kam ich zu Universal und damit zurück zu meinem Ursprung, der Klassik und dem Jazz.