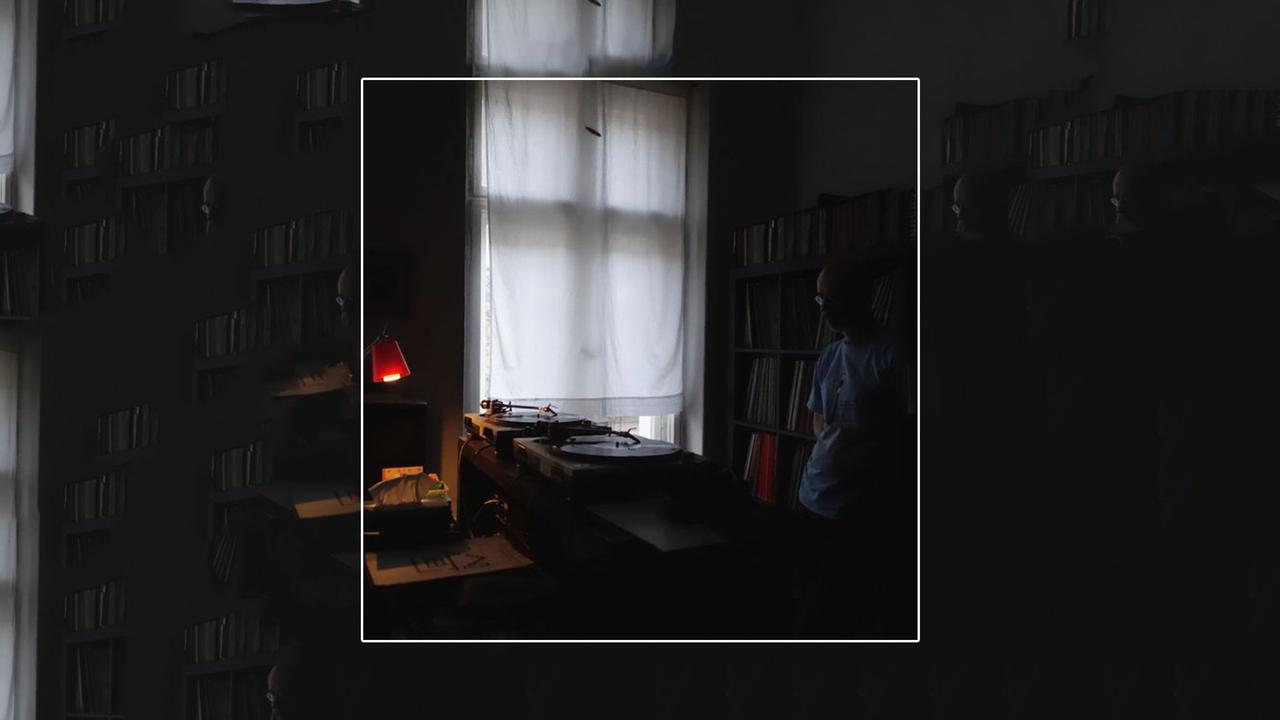Die Kimchi-TherapieJapanese Breakfast: die Indie-Überraschung des Jahres im Interview
30.11.2016 • Sounds – Interview: Ji-Hun Kim, Fotos: Susann Massute
Mit ihrem Debüt-Album „Psychopomp“ ist der Amerikanerin Michelle Zauner dieses Jahr ein großartiges Stück Musik gelungen. Ein feingeistiges, emotionales und exzellent geschriebenes Album zwischen LoFi, Indie, Shoegaze, elektronischem Pop und Folk, das auch Mainstream-Medien wie Pitchfork, NPR und Rolling Stone außerordentlich gut gefiel. Dabei ist der Hintergrund und die Entstehungsgeschichte der Platte ein recht trauriger.
Michelle Zauner verlor ihre Mutter durch Krebs. Sechs Monate lang pflegte sie sie daheim bis zu ihrem Tod – nebenbei entstand diese Platte. Nun war sie damit erstmalig in Europa auf Tournee. Das Filter traf die Künstlerin in Berlin zum Interview, entstanden ist ein privates und offenes Gespräch über fordernde Holländer, asiatische Identitäten in den USA und die heilende, magische Wirkung von Kimchi.
Du bist jetzt schon ziemlich lange unterwegs.
Ich war jetzt fast vier Monate nonstop auf Tour. Erst waren wir fünf Wochen in den USA mit Mitski und Jay Som unterwegs, eine Woche in UK, dann wieder fünf Wochen in den USA mit Porches, um dann wieder hier in Europa zu sein. Wir haben uns als Band ziemlich lange am Stück gesehen (lacht).
Wie anstrengend ist das?
Es ist natürlich anstrengend. Aber eine schöne Form der Anstrengung. Man macht, was man wirklich möchte. Man macht tolle Erfahrungen.
Du bist im Rahmen dieser Tour das erste Mal in Europa.
In der Tat!
Was hast du über Europa herausgefunden?
Wenn man als Tourist unterwegs ist, stelle ich es mir so vor: tagsüber die Stadt angucken und abends in Bars abhängen, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Bist du als Musiker unterwegs, dann bekommt man eher Zugang zu den einheimischen Eigenheiten. Man ist zur Arbeit da und dringt schneller durch touristische Scheinwelten. Ich habe eine Menge über Kulturen und Länder auf dieser Tournee kennenlernen dürfen. Oft kommen Leute nach den Konzerten und sind nahezu erpicht darauf, einem etwas über das Land und die Stadt näherzubringen. Als Tourist ist man den Leuten in der Regel ja erstmal egal (lacht).
Zum Beispiel?
Etjen, unser Tourmanager, macht das ja seit über 20 Jahren und er kennt bereits die lokalen Unterschiede. Er ist Holländer und ich wusste nicht, dass Holländer so direkt und geradeaus sind. Das fordert, ist aber auch ehrlich. Das sind gewissermaßen Stereotypen, an denen man sich abarbeiten kann, ich finde das interessant. Subtile Dinge und Eigenschaften, die ich zuvor einfach nicht kannte.
Dein Album „Psychopomp“ hat einen sehr persönlichen Hintergrund. Du verarbeitest darin den Tod deiner Mutter. Sie ist auch auf dem Cover zu sehen. Der Sound und die Songs sind recht intim. Wie fühlt es sich an, mit solchem Material plötzlich erst so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und es dann Abend für Abend vor fremden Menschen vorzustellen?
In den USA gibt es viele Asia-Amerikaner, die zu meinen Shows kommen und sich durch die Songs direkt angesprochen fühlen. In Europa hatte ich eher das Gefühl, dass die Leute ein bisschen reservierter sind. In Amerika kommen viele junge Leute auf mich zu und erzählen mir, dass sie kürzlich ihre Eltern oder Geschwister verloren haben. Oder dass bei einem ihrer Elternteile Krebs diagnostiziert wurde. Da werde ich nach den Shows schnell mit sehr persönlichen Erfahrungen konfrontiert. Wenn ein Musiker etwas sehr Persönliches mit dir teilt, dann glaubt man gleich, in Interaktion mit dem Künstler treten zu können. Das habe ich als Musikfan genau so erlebt. Hier in Europa habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Es könnte an der Sprachbarriere liegen. Oder man geht einfach nicht so offen damit um.

Deine Mutter ist jetzt quasi überall dabei?
Es ist schon seltsam, wenn man in Italien ist und plötzlich sieht man ein Foto seiner Mutter in der Stadt. Sie hat ja nicht mehr miterlebt, dass ich mit meiner Musik Erfolg habe. Das ist schon etwas ganz Besonderes für mich. Als wir in Heidelberg waren, musste ich an die Erzählungen meiner Eltern denken. Sie haben drei Jahre in dieser Stadt gelebt, noch bevor ich geboren wurde. Es klingt pathetisch – aber es fühlt sich an, als hätte meine Mutter mich erst in diese Richtung gebracht. Auch mit ihrem Tod. Ich habe zuvor fünf Jahre lang in diversen Bands gespielt, aber kein Projekt war so erfolgreich wie das jetzt. Es ist, als würde sie sich das alles von oben angucken.
Schicksal?
Ja, wenn auch ein trauriges. Aber es hilft mir, besser damit umzugehen.
Deine Mutter stammte aus Korea. Meine Eltern ebenfalls und jeder Koreaner hat eine ganz eigene, innige Beziehung zu Kimchi. Wie geht deine Geschichte mit Kimchi?
Ich bin in Seoul geboren und habe irgendwie immer Kimchi gegessen. Aber mein Vater ist Amerikaner und wenn man in den USA aufwächst, in einer Stadt wie Eugene, Oregon, wo es so gut wie keine Asiaten gibt, dann fühlt man sich mit diesem Teil der Identität nicht sonderlich wohl. Manchmal schämt man sich für seine Herkunft. Auch wenn ich wusste, dass das ein wichtiger Bestandteil von mir ist, habe ich das lange Zeit verdrängt. Ich hatte keine koreanischen Freunde, hatte immer Probleme die Sprache zu lernen. Aber das Essen war immer etwas, das mich direkt mit der Kultur verband. Wenn ich wie jetzt wochenlang in Europa bin und nicht weiß, wo ich koreanisches Essen herbekomme – mein Körper merkt das richtig. Das ist wohl ein Teil unseres Erbes. Man fühlt sich nicht vollständig, wenn das Essen nicht da ist. Das ist wie in dem Film „Chihiros Zauberreise“, wo Chihiro in die Geisterstadt kommt und das Essen der Leute essen muss, um Teil von ihnen zu werden. So ähnlich fühlt sich das bei mir an. Nach dem Tod meiner Mutter bekam ich es mit der Angst zu tun und ich bin förmlich in ihre Kultur hineingesprungen. Ich hatte schlichtweg das Gefühl, dass ich durch ihren Tod den Zugang zu diesem Teil meiner Person verlor. Ich bin Einzelkind. Alle Verwandten meiner Mutter leben in Korea und als sie plötzlich nicht mehr da war, hatte ich das Bedürfnis, da Boden gut machen zu müssen.
Du hast begonnen, Koreanisch-Sprachkurse zu besuchen. Und gelernt Kimchi zu machen.
Meine Mutter hat zu Hause nie Kimchi gemacht. Wir haben es immer gekauft. Aber als sie verstarb, war ich versessen, zu lernen, wie man Kimchi macht. Das hatte eine große therapeutische Wirkung. Es fühlte sich sehr gut an, etwas zu tun, das in der langen Geschichte meiner Familie eine so wichtige Rolle gespielt hat. Mir macht es viel Freude, es ist Arbeit mit den Händen, es ist kreativ, du erlernst dieses Gefühl, wenn die Reifung einsetzt und plötzlich erkennst du: Das ist richtig so. Und wenn ich Kimchi mache, stelle ich mir immer vor, wie es wäre, wenn meine Mutter das sehen und dabei sein würde. Ihr hätte das bestimmt gefallen. Wenn ich koreanisch esse, kann ich meine Mutter fühlen. Wenn ich ein 찜질방 (Jjimjilbang/koreanisches Badehaus) besuche oder Koreanisch lerne, dann fühle ich mich ihr sehr nahe. Als meine Mutter an Krebs erkrankte, habe ich mich sechs Monate lang um sie gekümmert. Das Trauma zu erleben, wie sich Menschen während der Chemotherapie verändern, das hatte Auswirkungen auf mich. Bis hin zu dem Punkt, als ich plötzlich vergaß, wie meine Mutter vor der Krankheit war. Als ich Koreanisch lernte, kam mir immer wieder in den Sinn, wie meine Mutter die selben Worte sagte. Erinnerungen kamen hoch, die nicht nur mit meiner kranken Mutter zu tun hatten, sondern mich an bessere Zeiten erinnerten: Als ich noch ein Kind war und sah, wie gerne meine Mutter 호떡 (Hoddeok/gebratener Pfannekuchen mit heißer Zucker-Zimtfüllung) gegessen hat. Oder als wir zusammen in Korea waren und 칼국수 (Kalguksu/Nudelsuppe mit geschnittenen Weizennudeln) gegessen haben. Wenn ich heute diese Gerichte mache, dann denke ich auch an diese Zeiten. Koreanisches Essen half mir also enorm, nicht mehr nur Traumata und Albträume zu haben und an meine kranke Mutter denken zu müssen.

Essen kann Heimat bedeuten. Bei mir ist es so, dass ich zwar viel und regelmäßig koreanisch koche, das Kimchi allerdings kommt noch immer von meiner Mutter. Es ist, als müsste ich ihr diese eine Kompetenz lassen, auch weil bei ihr so viel Liebe durch den Magen geht. Jedes Mal also, wenn wir uns sehen, nehme ich kiloweise eingelegten Chinakohl mit nach Hause. Wenn ich Kimchi kaufe, fühlt sich das wie Betrug an. Aber auch in deinen Videos kommt das Korea-Thema immer wieder auf: Mal trägst du ein 한복/Hanbok, die traditionelle Tracht, dann bist du Karaoke singen. Asien war doch eigentlich bislang immer ziemlich uncool, was Popkultur anbetrifft.
Ich glaube schon, dass es viele amerikanische Popstars gibt, die immer wieder asiatische Einflüsse verarbeiten. Katy Perry oder Gwen Stefani zum Beispiel. Es gibt Videos, da sieht man weiße Männer, die durch Chinatown laufen. Aber wie dem auch sei. Zur Zeit, als wir das Video zu „Everybody Wants To Love You“ produzierten, wurde ich oft gefragt, was es für mich bedeuten würde, asia-amerikanisch zu sein. Ich bin einerseits froh, das ein Stück weit für andere Menschen repräsentieren zu können, auch weil es mir viel bedeutet. Aber auf der anderen Seite ist es seltsam, dass man immer wieder damit konfrontiert wird. Wie oft wird man in den USA auf seine deutschen oder irischen Wurzeln angesprochen? Das passiert nicht. Man wird auch nicht gefragt, inwiefern diese Wurzeln die Musik beeinflusst haben. Aber so ist das nun mal. Bei mir gibt es ja auch keine traditionellen koreanischen Instrumente. Daher repräsentiere ich wohl eher eine Art Karikatur des Koreanischseins. Am Ende bin ich Working-Class-American.
Wieso haben Koreaner keinen HipHop erfunden?
Naja, sie haben K-Pop erfunden.
Fair enough.
Wenn das nicht reicht … (lacht)
Stimmt es, dass du mit einem Reiskocher auf Tour gehst.
Ja! Wenn ich keinen Reis bekomme, drehe ich durch.
Würdest du sagen, dass du auch ein bisschen in die asiatische Rolle gedrängt wirst?
Als ich das Album aufnahm, hatte ich ja null Erwartungen, ich habe einfach die Dinge aufgearbeitet, die mir wichtig waren. Zunächst habe ich das für mich gemacht. Ein wirklich kleines Label hat das dann veröffentlicht. Dass es so viel Aufmerksamkeit gab, hat alle überrascht. Ich habe mir dabei die Freiheit genommen, auch bei den Videos, all die Dinge zu machen, die ich wirklich machen will. Das positive Feedback hat mich darin bestärkt. In der Regel werden Dinge doch erst dann gut, wenn sie persönlich sind. Falls sie kommerziell scheitern, hat man wenigstens etwas gemacht, was für einen selbst von Bedeutung ist. Die Musiklandschaft in den USA hat sich durchaus verändert. Es gibt ein größeres Interesse daran, weibliche Indie-Künstler zu signen. Schwarze oder auch asiatische Frauen. Das ist erstmal positiv zu sehen.
Wie ist es dazu gekommen?
Es wurde Zeit. Es hat schon sehr lange gedauert, dass es solch eine Akzeptanz für Künstlerinnen gibt. Ich glaube auch, dass Soziale Medien geholfen haben, dass wichtige Diskussionen darüber geführt werden, dass Meinungen eine Plattform zur Verfügung steht. Wenn jemand beschreibt, wie sie ungerecht behandelt wurde, dann kann man diese Erfahrung teilen und es gibt Hilfe, Unterstützung und Zuspruch von der Community. Man schafft Diskurse. Das kann man als Fortschritt sehen.

Was wird das erste sein, was du nach der Tour in den USA machst?
Kimchi! (lacht) Im Ernst. Das allererste, was ich machen werde ist 총각김치(Chonggak-Kimchi/Kimchi aus jungem Rettich). Das ist einfach mein liebstes Kimchi. Mein Mann hat eine neue Wohnung für uns besorgt und dort werde ich mich natürlich erstmal einrichten und einleben. Dann geht es in den Supermarkt, ich werde Rettich besorgen und Kimchi einlegen. Danach möchte ich tagelang nur kochen.
Was war das Beste, was du auf Tour gegessen?
In der Schweiz gab es tollen Käse. Dann erinnere ich mich auch an ein super Gersten-Risotto (schaut Richtung Schlagzeugerin auf der Couch nebenan). Sag mal, was haben wir sonst noch Gutes gegessen?
Schlagzeugerin: (lacht) Tatsächlich das koreanische Restaurant in Heidelberg.
Stimmt. Da gab es 짬뽕 (Jjambbong/scharfe Nudelsuppe mit Meeresfrüchten), die war gut. Da waren so viele koreanische Touristen. Wieso ist das so?
Weil, wenn Koreaner Urlaub machen, sie in der Regel nur eine Woche Zeit haben, um ganz Europa zu sehen. Daher gibt es koreanische Reiseveranstalter, die sich auf diese Art des Urlaubs spezialisiert haben. Die Standards in Deutschland sind die Loreley am Rhein, wegen des bekannten Lieds, das in Korea jedes Schulkind lernt, Neuschwanstein und alte, historische Städte wie Heidelberg. Heidelberg gilt quasi als Archetyp einer mittelalterlichen europäischen Stadt. Die Koreaner lieben Beethoven, Goethe, Schiller, Schopenhauer. Viele kennen sich damit besser aus als Deutsche. Für Deutsche beispielsweise ist die Loreley ja vollkommen uninteressant. Die Schweizer Alpen sind ebenfalls bei Japanern und Koreanern sehr beliebt. So rattert man in einem Bus tausende Kilometer in wenigen Tagen ab. Hält jeweils kurz, macht ein Foto und fährt weiter, bis der Urlaub vorüber ist und man daheim stolz zeigen kann, was man alles in so kurzer Zeit gesehen und erlebt hat. Am Ende wurde die meiste Zeit im Bus verbracht und in koreanischen Restaurants gegessen.
Wow, echt jetzt? Deshalb gab es in Heidelberg das koreanische Restaurant, das war auch direkt an einer Touristenattraktion. Faszinierend. Das ist echt lustig.
Wie geht es musikalisch weiter?
Japanese Breakfast ist zur Zeit mein Hauptprojekt. Wir werden wieder ins Studio gehen und am nächsten Album arbeiten. Craig Hendricks, der als Bassist mit auf Tour ist, hat ein Studio und wird das Album koproduzieren. Zur Zeit gibt es sechs Demos, das wollen wir erweitern und im Dezember gibt es hoffentlich erste finale Ergebnisse. Ein Großteil ist bereits angelegt. Das wird aufregend. Sich wieder den kreativen Prozessen zu widmen – darauf freue ich mich seit langem. Und im August 2017 werden wir wahrscheinlich wieder in Deutschland und Europa sein. Gut möglich, dass das Album kurz vorher schon veröffentlicht wird.