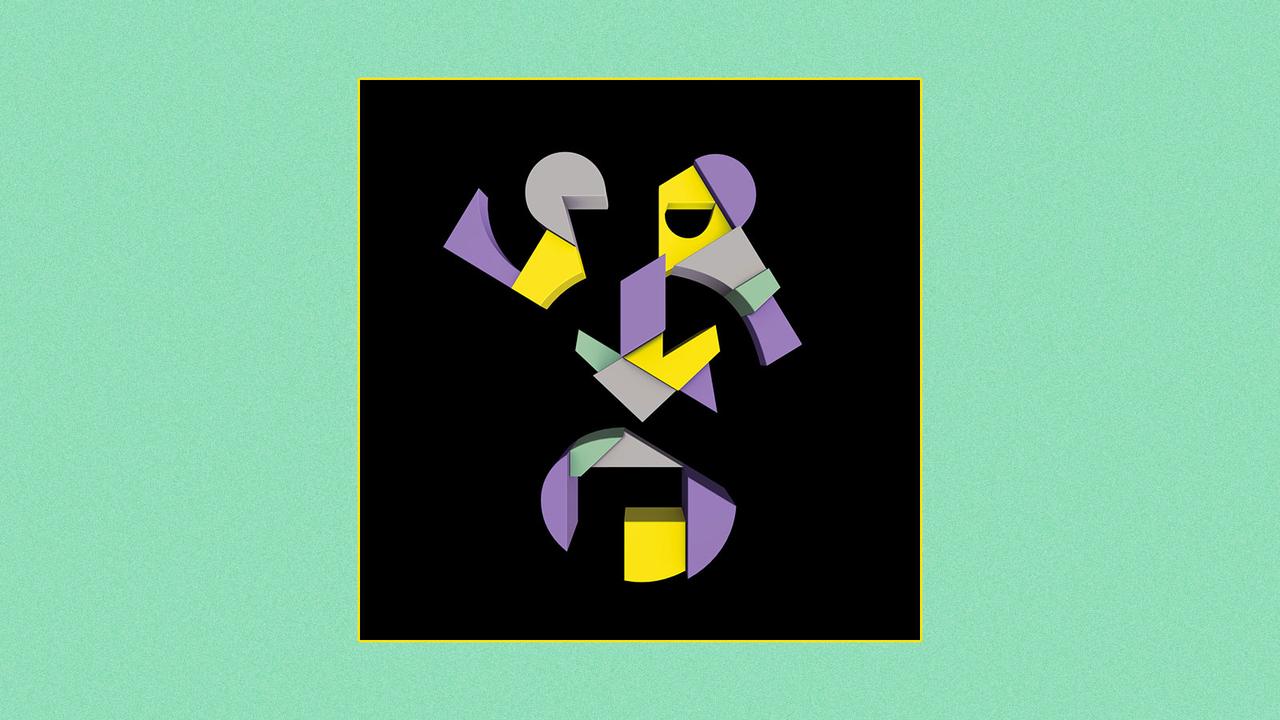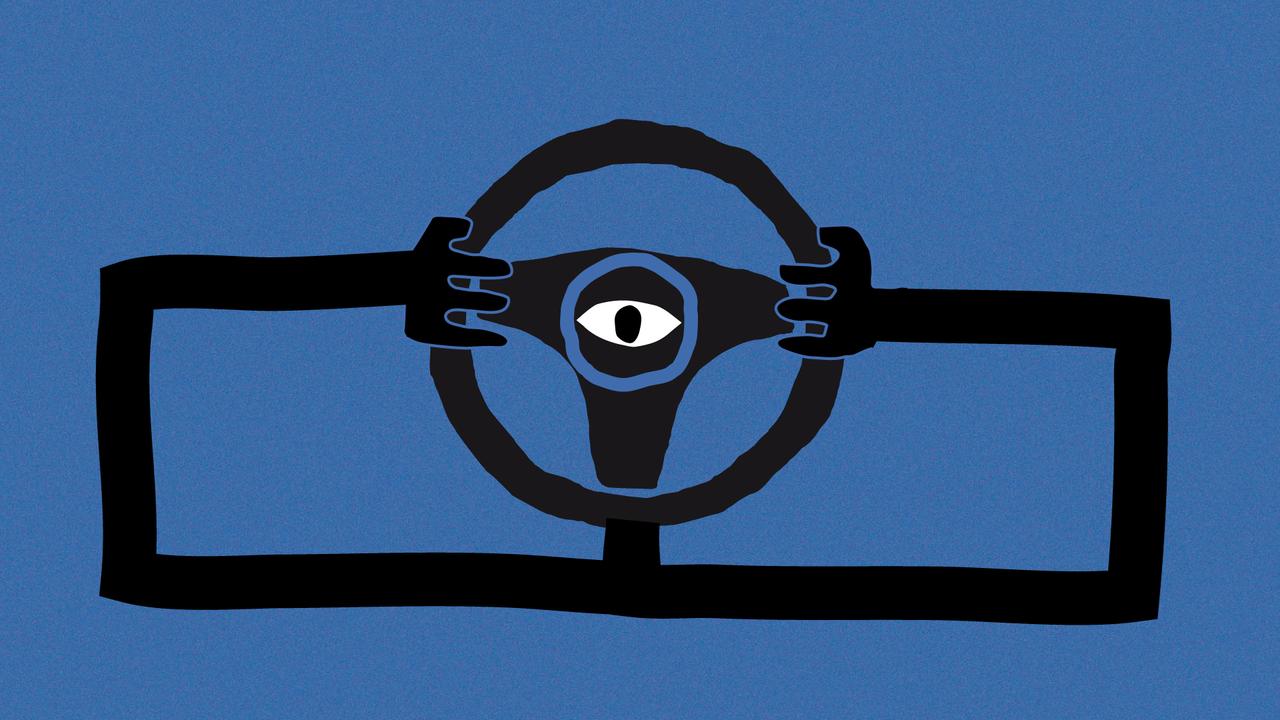„Es muss auf der Oberfläche funktionieren“Interview: Actress über Orchester, Ideale und Musik als Malerei
27.4.2018 • Sounds – Interview: Raoul Kranz
Photo: Denelle & Tom Ellis
Geht es um experimentelle und bisweilen schwergängige Elektronik, ist der Name Actress nicht weit. Mit Releases auf seinem eigenen Label Werk Discs und mehreren Alben auf Ninja Tune hat sich Darren Jordan Cunningham in die obere Hemisphäre des elektronischen Anspruchs produziert, 2016 tat er sich für mehrere Live-Shows mit dem London Contemporary Orchestra (LCO) zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit ist im letzten Jahr bereits die EP „Audio Track 5“ entstanden, im Mai folgt nun der Langspieler „LAGEOS“. Unser Autor Raoul Kranz hat Actress getroffen und ihn über die Zusammenarbeit mit dem LCO, das Handwerk damals und heute, seine musikalischen Ideale und das Livespielen ausgefragt.
Deine letzte EP „Audio Track 5“ war bereits eine Kollaboration mit dem London Contemporary Orchestra, im Mai erscheint nun eure LP „LAGEOS“ auf Ninja Tune. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
Ich habe vor zwei Jahren angefangen, mit dem LCO für eine Show im Barbican Centre [das größte Kultur- und Kongresszentrum in London, Anm.d.Red.] zu arbeiten. Damals hatte ich zunächst ältere Tracks ausgewählt, wir haben sie dann auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, um meine Ideen mit zusätzlichen Computer-Manipulationen akustisch umzusetzen. Nach den Konzerten dachten wir: Es wäre doch gut, das Ganze mal im Studio aufzunehmen. Dann gab's natürlich die EP „Audio Track 5“, quasi ein Remix der Ideen. In den letzten Monaten haben wir einzelne Elemente abgestimmt und verfeinert, gewisse Sachen auch hier in Berlin aufgenommen. Ich mag das, viele kleine Teile zusammenzubringen. Es ist auch mehr hinzugekommen, keine bloße Reproduktion der Shows.
Ich mag es ja sowieso, an orchestralen Tracks zu basteln. Bevor ich das ganze Orchester getroffen habe, lud ich den Dirigenten Hugh Brunt in mein Studio ein und zeigte ihm, wie ich gewisse Ideen programmiere, um mein eigenes Orchester zu erschaffen. Dadurch bekam er schonmal einen Eindruck meiner Arbeitsweise. Aber als die Musik notiert wurde, wir anfingen zu proben und anfingen, hauptsächlich über die Musiktheorie zu kommunizieren, da wurde es tatsächlich ziemlich ungewohnt für mich. Es ist, als hielte dir jemand einen Spiegel vor, der dir genau zeigt, was passiert, aber du musst nachschlagen und versuchen, es rückwärts zu verstehen: „Ah ok, das ist es, was ich hier gemacht habe, und das habe ich dort gemacht – ja, ergibt Sinn.“
Du hast die Theorie hinter dem gelernt, was zuvor im Studio ganz intuitiv entstanden ist?
Genau. Wenn ich allein Musik mache, passiert ganz viel unbewusst, natürlichen Impulsen folgend. Die Arbeit auf dieser sehr sachlichen Ebene zu betrachten, war faszinierend.

Das Cover der letzten Platte „AZD“.
Ist die Zusammenarbeit mit dem Orchester eine Weiterentwicklung vom Sound des Vorgängers „AZD“, der im Vergleich zu deinen ersten Alben deutlich zugänglicher und positiver klingt?
Warum denken die Leute das eigentlich (lacht)?
Du tust es nicht?
Das kann ich so nicht mit Bestimmtheit sagen. Mich interessiert einfach, warum die Leute das denken. Es ist mein erstes Album, das in Teilen vielleicht Retro klingt und auf dem ich ausschließlich mit Synthesizern gearbeitet habe.
Du hast zu der Zeit deine Produktionsweise stark geändert?
So ist es. Auf früheren Alben habe ich eher mit gesampelten Sounds und am Computer gearbeitet. „AZD“ hingegen wurde viel direkter mit Hardware programmiert, dann aufgenommen und nur wenig bearbeitet. Jetzt klingt alles verschwommener. Ich habe lang nach einem gewissen Ausdruck gesucht, bzw. einer ausdrucksstarken Farbe innerhalb meines Sounds. So wurde aus dem matschigen LoFi-Grau ein flüsternd, silbernes Grau – so kam ich dann zu Chrom.
Wie die auf dem Cover zu sehen?
Exakt. Chrom reflektiert Farbe, aber erzeugt sie nicht.

Du bist schon lange im Geschäft, routiniert. Ist das Gefühl beim Produzieren eines neuen Tracks noch immer etwas Besonderes?
Jede Idee, die du aus deinem Kopf ziehst und umsetzen kannst, erzeugt ein besonderes Gefühl. Die Herausforderung besteht mittlerweile eher darin, herauszufinden, wann alles passt. Ich kontrolliere immer alles, analysiere, frage mich, ob ich erreicht habe, was ich wollte, ob dies und jenes korrekt ist – oder auch, ob dieser Fehler dort okay ist.
Du bist also ziemlich streng mit dir selbst?
Nicht unbedingt. Ich behalte den Überblick, aber normalerweise sagen mir die Klänge, ob etwas passt oder nicht. Hat dieser Sound mit jenem über diese Zeitspanne funktioniert? Ja, dann Häkchen dran. Arbeitet der Bass richtig in dieser Umgebung? Weil ich nichts subbe, also Bässe nicht konventionell abmische, muss – so könnte man sagen – alles auf der Oberfläche funktionieren.

Actress x LCO, Photo: Mehdi Lacoste
Versuchst du dich beim Musikmachen von anderen Einflüssen fern zu halten oder lässt du dich die ganze Zeit inspirieren?
Ich schaue mir die ganze Zeit Kram an und höre viele verschiedene Sachen. Beim Autofahren kann das auch mal ein 80er-Sender sein, oder 90er-R’n’B. Manchmal drücke ich dabei sogar auf Aufnahme. Ich bewege mich immer in unterschiedlichen Zonen, bestimmte Dinge berühren mich zu bestimmten Zeiten. Musikhören, Musikmachen, das passiert alles gleichzeitig.
Actress gilt als Schlüsselfigur experimenteller Elektronik, wie fühlst du dich in dieser Rolle?
Ganz normal (lacht) – komischerweise. Oder nein: Ich versuche vielmehr, das normal zu finden. Die Musik macht mich glücklich, ganz egal wie melancholisch es darin manchmal zugeht – und das will ich hörbar machen. Aber klar ist der Erfolg cool. Nicht zuletzt auch, weil ich die ganzen Musiker kennenlerne, die ich respektiere.
Hast du von sowas geträumt, als du vor fast 15 Jahren angefangen hast?
Im Grunde ist es einfach passiert. Aber es hat ja letztlich nur mit der Musik zu tun. Wenn dein Schaffen und wie du es präsentierst bei gewissen Leuten mitschwingt, dann ist das authentisch. Die Musik, die ich mag, ist authentisch, egal ob Techno, Garage oder House. Das merkst du immer. Authentizität ist mir das wichtigste in der Musik, damit beschäftige ich mich die ganze Zeit.
Machst du dir keine Gedanken darum, Erwartungen zu brechen?
Letztlich nicht, das ist nicht immer leicht. Eine Platte, die ich auf meinem Label Werk Discs rausbringe, würde ich zum Beispiel eher nicht auf Ninja Tune veröffentlichen. Dahingehend spielen Erwartungen schon eine Rolle, aber für mich ist das Teil der Herausforderung. Ich habe ja ein sehr spezielles Interesse an Popmusik, aber werde das immer von einer künstlerischen Perspektive angehen. Und das ist für mich der Hauptunterschied zwischen einem reinen Produzenten und einem Künstler. Du kannst beides sein, aber die Frage ist immer, wie du die Kunst produzierst. Nehmen wir zum Beispiel Andy Warhol und The Velvet Underground. Du könntest Warhol den Produzenten nennen, obwohl es definitiv Produzenten innerhalb der Band gab. Aber er produzierte ein gewisses Image für die Band, war also in anderer Hinsicht Produzent, als die Musiker. Oder jemand wie Quincy Jones, der perfekt notieren kann, aber auch extrem wirtschaftlich denkt, um die richtigen Leute zusammenzustellen, damit er genau das Ergebnis bekommt, das er will. Ich sehe Musik immer eher als Objekt und denke gar nicht über das Publikum nach. Manche Leute konzentrieren sich da wirklich krass drauf. Manchmal kannst du auch einfach machen, was das Publikum braucht, ganz ohne darüber nachzudenken - und das ist Kunst, schätze ich.

Photo: Mehdi Lacoste
Ich erinnere mich, wie sie uns an der Uni mal Kompression und die dazugehörigen Einstellungen beigebracht haben. Da hieß es dann: „Ihr solltet das nicht so einstellen, denn dann erzeugt ihr einen pumpenden Sound, das wollt ihr nicht.“ Wenn mir jemand so was sagt, denke ich mir: Das ist genau, was ich will. Warum sagst du mir, dass ich das nicht will? Wo steht das, gibt es ein Lehrbuch, das eine pumpende Kompression verbietet? Ich möchte diesen Effekt, hört sich super an. Das sind die Kleinigkeiten, die die Ästhetik meiner Musik so anders machen. Das habe ich auf dem Album „Splazsh“ – wahrscheinlich meine rebellischste Platte – und teils auch auf „R.I.P.“ im Blick gehabt.
Du sagtest mal, du siehst dich als Architekt oder Maler von Sound, versuchst tatsächlich die Töne und Parameter wie Farben und Pinselstriche zu sehen. Gehst du bis heute so abstrakt an die Sache ran?
Ja, definitiv. Ich mag es, wenn sich Ideen über eine Zeitspanne wiederholen, aber gleichzeitig eingefroren sind – als wäre das Narrativ in der Musik eingefroren. Wie ein Maler, der immer wieder die gleichen Motive zeichnet, wie Matisse mit „Der Tanz“, den im Kreis tanzenden Menschen, die er mehrfach gemalt hat. Ich mag die Vorstellung von nebliger Musik mit amorphen Kraftwerk-Snares und einem Ambiente, das ziemlich unterschiedliche Sätze spielt. Ich mag Tracks, die sich eher stetig entwickeln als offensichtlich strukturiert verlaufen.
Ich habe das Gefühl, in deiner Musik geht's weniger um den eigentlichen Inhalt als um eine Veränderung der Räumlichkeit oder Perspektive.
Absolut, deshalb spielt Isolation auch eine große Rolle. Deshalb reise ich gerne, denn du ziehst ständig durch andere Umgebungen. Dein Kopf verhält sich jedes Mal anders. Anschließend kannst du wieder zurück in deinen Raum eintauchen. Deshalb mag ich auch Soundchecks. Die verschiedenen Orte beim Soundcheck immer wieder neu einzustimmen, ist eine einzigartige Erfahrung und einer der Hauptgründe, warum ich das Touren tatsächlich genieße.

Photo: Tom Morgan
Apropos Liveset: Wie gehst du das Thema grundsätzlich an? Du bist auch mit einer A/V-Liveshow unterwegs.
Es ist auch für mich jedes Mal etwas neues. Das macht es ja erst spannend. Meine Erfahrung ist der des Publikums also gar nicht unähnlich. Ich habe eine grobe Idee, wohin es gehen kann, ein paar Pfade, die ich einschlagen kann. Aber bevor ich das nicht tatsächlich gespielt habe, weiß ich nicht genau, wie es klingen wird. Wenn ich live spiele, nehme ich meine Sounds gern auseinander, lasse sie auf Standfestes wie die massiven Kickdrums und Snares der 909 prallen, nehme diese dann weg und stehen bleibt ein umherrschwirrender Sound, um den sich dann alles dreht. Ich handle dabei eher prozessorientiert, eine hochgradig narratierte Liveshow ist nichts für mich. Performen basiert auf Elementen wie Improvisation, Zufall und Fehlern. Die visuelle Ebene begleitet das mit Störbildern und Grafiken, die jene Pfade der Musikproduktion und Klangräume dann abbilden.
Du bist ja häufiger in Berlin, um zu spielen. Wie gefällt’s dir hier eigentlich?
Berlin ist cool. Als ich meine Heimatstadt verließ und in London ankam, dachte ich schon bald an einen weiteren Umzug nach Berlin. Ich war in dieser Phase, komplett in Schwarz gekleidet, und fragte mich: Was ist der kälteste, industriellste und härteste Ort, den ich mir vorstellen kann? Berlin? Yeah, Berlin. Also wäre ich fast von London nach Berlin gezogen, weil ich die Vorstellung mochte, in einen Bunker zu ziehen und einfach harten Techno zu machen. Das war mein Ding damals. Ich kaufte Platten von Tresor Records, Basic Channel, und Chain Reaction. Ich hörte einiges über Maurizio, und es schien, als ging in Berlin damals richtig viel ab. Natürlich zog auch Richie Hawtin um. Aber ich blieb im UK, weil Ost-London anfing durchzukommen. Zu der Zeit gab es immer noch viel Drum and Bass, aber die Nächte veränderten sich – du konntest es wirklich fühlen. Ich merkte dann doch, dass sich das Bleiben lohnen würde. Und schließlich lernte ich die richtigen Leute kennen, veranstaltete Club-Nächte – und wir erschufen tatsächlich unsere eigene Philosophie in London.
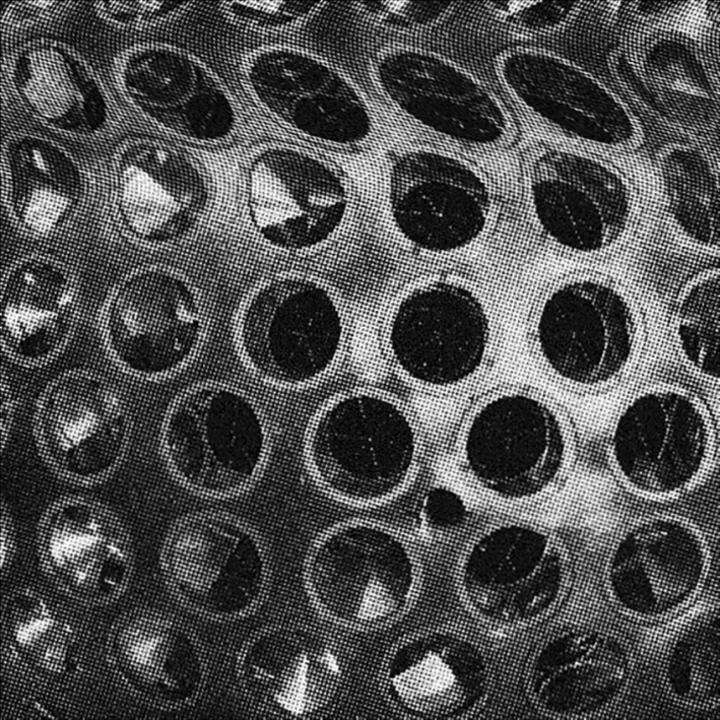
„LAGEOS“ erscheint am 25.05.2018 bei Ninja Tune.