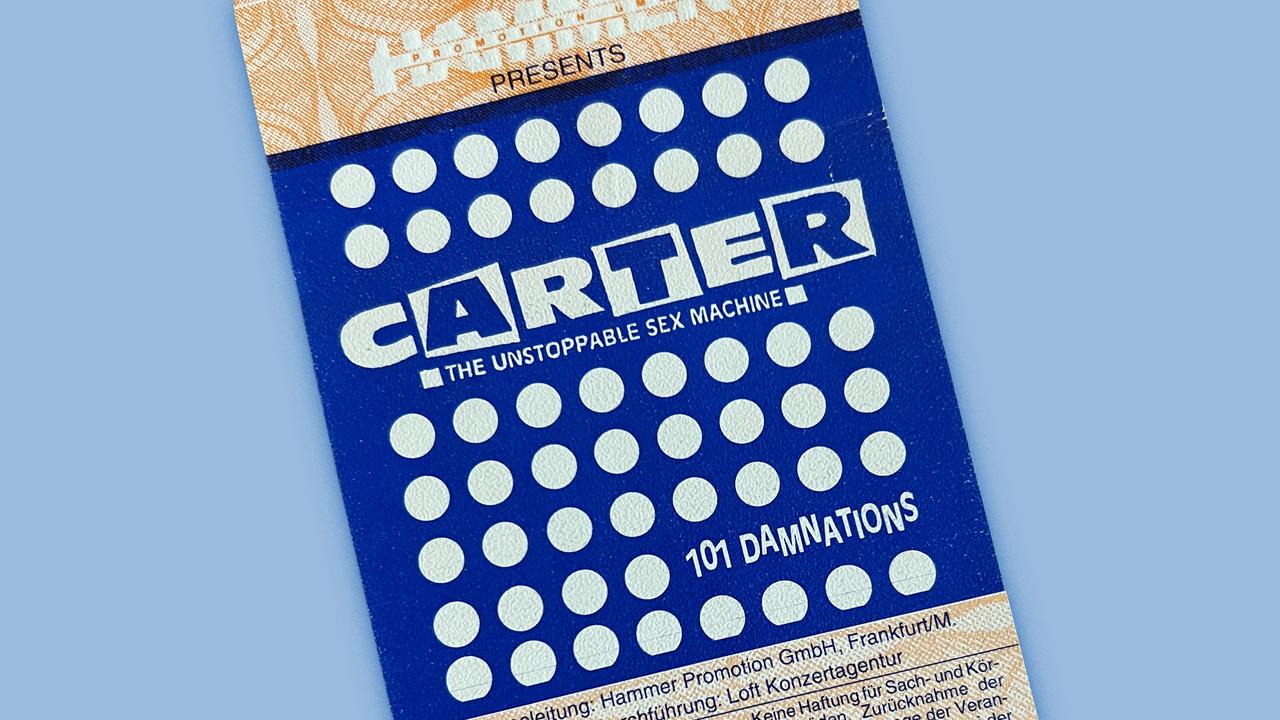Das Problem mit SpotifyWie Streaming die Popkultur in den Konkurs treibt
16.2.2022 • Kultur – Text: Ji-Hun Kim
Photo by Wesley Tingey on Unsplash
Massive Kurseinbrüche und schlechte Presse bestimmen die Diskurse rund um den Streaming-Giganten Spotify. In den letzten Jahren wurde dabei vor allem eines deutlich. Das Unternehmen interessiert sich so viel für Musikkultur wie Exxon für den Klimawandel. Über Joe Rogan, hunderte Millionen, die in die falsche Richtung investiert werden und weshalb es Zeit ist, neue Infrastrukturen zu schaffen, die auf Selbstbestimmtheit und Nachhaltigkeit basieren.
Der Musikstreaming-Gigant Spotify steht dieser Zeit viel in den Schlagzeilen. In den USA ist es vor allem die Causa Joe Rogan, die für Aufsehen sorgt. Der Superstar-Podcaster, der von Spotify 100 Mio. Dollar bekommen hat, um das Audio-Portfolio aufzuwerten, stand zwar damals schon in der Kritik. Das war dem Unternehmen jedoch redlich egal. Es geht ja wie so oft im digitalen Plattformkapitalismus gemeinhin um Performance und Wachstum. Erst mit dem konsequenten Leugnen von wissenschaftlichen Fakten rund um das Globalthema Corona wurden die Shitstorms größer. Musiker*innen wie Neil Young und Joni Mitchell zogen ihre Kataloge von Spotify ab. Ein vermeintlich politisch korrekter Move. Am Tag darauf wurden eben jene bei der Konkurrenz von Apple Music besonders präsent beworben. Es zeigt aber auch nur, wie Oldies wie Neil Young immer wieder versuchen, sich lautstark in die Diskurse einzubringen, aber mit popkultureller Relevanz kaum aufzuwarten haben. So, who actually cares?
Spotify-CEO Daniel Ek versuchte unterdessen zu beschwichtigen. Später stellte man fest, dass in unzähligen vergangenen Episoden der rassistische Mr. Rogan auch noch das N-Wort in den Mund nahm, woraufhin viel Content von der Streaming-Plattform verschwand. Die Story ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Nachdem immer mehr Artists ankündigten, ihre Musik von Spotify runterzunehmen und sogar Joe Rogan zerknirschte Lippenbekenntnisse aka Entschuldigungen von sich gab, gab nun auch Spotify halbherzig klein bei und versprach 100 Mio. Dollar in die Förderung und Unterstützung von Audio-Formaten marginalisierter Gruppen zu investieren. Am Deal mit Rogan wolle man aber weiterhin festhalten. Eine Posse wie aus dem Bilderbuch, und man wünscht sich Hände wie Bootspaddel, um sein fremdverschämtes Gesicht dahinter zu verstecken. Wenn ein Wald im Amazonas brennt, verspricht man am besten in drei Jahren neue Bäume in Europa zu pflanzen. Nun hat auch noch die Plattform Rumble, in die der libertäre Investor und Trump-Supporter Peter Thiel involviert ist, Joe Rogan nochmal 100 Mio. Dollar angeboten, damit er die Seiten wechselt. Bei Rumble könne er reden und denken, wie er will. Hier gäbe es keine woken Feindeshorden, geschweige denn hysterische Cancel-Culture. Offenbar kommen gerade alle in die Newsrooms, wenn man sich nur irgendwie zum Thema Joe Rogan äußert. Und es kristallisiert sich mal wieder die Frage heraus: Wieso belohnt diese Welt die größten Schweine eigentlich immer am meisten?
Genauso wenig Facebook und Instagram Interesse an aufrichtigem Journalismus oder deepen Storys haben, hat Spotify augenscheinlich kein ausgeprägtes Interesse an einer gesunden Musikkultur.
Das denken sich unzählige Musiker*innen Acts und Bands, die seit Jahren von Spotify ausgebeutet werden. Dass die Tantieme mikroskopisch mickrig sind und nur wenige damit über die Runden kommt, dennoch trotzdem alle darauf angewiesen, weil sonst noch viel weniger Geld in der Tasche landet, ist bekannt. Dabei begann die Ära des legalen Streamings noch verheißungsvoll. Aber heute ist es Spotify wirtschaftlich ziemlich egal, ob bekannte Artists noch auf der Plattform vertreten sind oder nicht. Es wird immer deutlicher: Spotify ist schlichtweg kein Musikunternehmen, war es auch nie, interessiert sich nicht für Musik und ist am Ende sogar musikfeindlich. Auf der soziokulturellen Power der Popkultur ist man all die Jahre parasitär gesurft. Dass ausgerechnet ein Nichtmusiker wie Joe Rogan einen der fettesten Deals der Firmengeschichte eingeheimst hat, ist nur eine der vielen Facetten, die das deutlich machen. Der Gründer Daniel Ek mag zwar beteuern, dass er als Kind musikalisch war und prima Gitarre spielen konnte. Aber er hatte es auch nie nötig, eine Biografie als Artist zu leben. Empathielosigkeit könnte man das nennen. Es ist aber auch Kalkül. Wie bei Facebook machte man sich erst zum Marktführer und unverzichtbar. Nun kommt niemand mehr aus dieser digitalen Hölle mit Einzelhaft heraus. Genauso wenig Facebook und Instagram Interesse an aufrichtigem Journalismus oder deepen Storys haben, hat Spotify augenscheinlich kein ausgeprägtes Interesse an einer gesunden Musikkultur. Eine paradoxe Gemengelage. Auf der einen Seite haben wir das größte Angebot an verfügbarer Musik aller Zeiten, gleichzeitig lässt es sich aber mit einem Discounter vergleichen. Zwar mag es sein, dass Gemüse und Fleisch überflüssig und zu günstigsten Preisen für alle Zeiten verfügbar ist. Aber ob die Böden, Ställe, Felder und Produzent*innen gesund sind und nachhaltig überleben können, wird am besten gar nicht erst hinterfragt. Ist doch alles so praktisch und einfach. Und verspricht den Unternehmen Profit.

Musiker*innen protestieren im Frühjahr 2021 vor der Zentrale von Spotify in San Francisco | Photo by Patrick Perkins on Unsplash
Das wird auch deutlich, wenn man sich das Geschäftsgebaren von Spotify, respektive von CEO Daniel Ek, der letzten Zeit genauer anguckt. Ek ist mittlerweile Multimilliardär, im Frühjahr 2021 wollte der Schwede den englischen Fußballverein Arsenal London für einen Milliardenbetrag kaufen. Da er schon immer Fan des Clubs gewesen sei. Und was soll man mit dem vielen Geld auch sonst machen?, so der Unterton. Für Normalsterbliche ist es noch immer schwer verstellbar, was eine Milliarde eigentlich ist. Jeff Bezos und Elon Musk haben mittlerweile Vermögen in dreistelliger Milliardenhöhe. Zum Vergleich: Angenommen man wäre im Jahr 1755 geboren. Ein Jahr vor der Geburt von Wolfgang Amadeus Mozart, 34 Jahre vor der Französischen Revolution. Nun würde man vom ersten Tag der Geburt an jeden einzelnen Tag 10.000 Euro bekommen. 10.000 Euro sind eine Menge Geld, und gerade Künstler*innen und Musiker*innen kommen damit oft ein Jahr lang aus. Doch selbst bei einer so illusionären Lebenszeit von 267 Jahren – die erste Milliarde wäre bis heute nicht erreicht. Der Deal zwischen Ek und Arsenal kam indes nicht zustande. Ek äußerte sich auf Twitter ob des geplatzten Hobby-Projekts angefasst. Stattdessen investierte er im November letzten Jahres 100 Millionen Euro in das KI-Unternehmen Helsing, das in Rüstung macht. Helsing ist ein Münchener Start-up, das mit Hilfe von Deeptech-Software Kriegseinsätze optimieren will. Nun kann und sollte es uns egal sein, was Milliardäre mit ihrem Geld privat machen. Allerdings ist der Reichtum von Daniel Ek auf der prekären Arbeit vieler Musiker*innen auf der ganzen Welt entstanden, die eben nicht Drake, Ed Sheeran oder Cardi B heißen. Das darf man nicht vergessen. Und in der Tat, die gibt es auch noch und genau die machen die Vielfalt des Angebots aus. Etwas, worüber man sprechen sollte: Man könnte ja auch etwas davon zurückgeben.
Pustekuchen. Nun macht die News die Runde: Spotify wird aller Voraussicht nach als Sponsor des hoch verschuldeten, katalanischen Fußballvereins FC Barcelona einsteigen. Zum einen als Trikotsponsor, aber auch das legendäre Stadion Camp Nou könnte bald den Namen des Streaming-Services tragen. Dafür ist eine Summe von 250 Mio. Euro im Gespräch. Auch hier stellt sich die Frage: Was hat die Musik-Community, alle Indie-Labels eingeschlossen, von so einer Aktion? Nicht, dass man als Fußball-Fan nicht auch Spaß dran hätte, mit Xavi oder Frenkie de Jong abzucornern und elegante Kicks in Barcas VIP-Lounges bestaunen möchte. Aber man kann nicht oft genug fragen: Wer soll davon profitieren? Wahrscheinlich Investoren, die man damit bespaßen kann. Zumal Spotify weiterhin keine Gewinne schreibt, viel Geld ausgibt und investiert, allerdings ein valides Gewinnmodell durchaus dazu genutzt werden könnte, Tantieme zu erhöhen und fairer zu gestalten. Das, was Spotify seit Jahren zumindest vorgibt zu versprechen.

Das altehrwürdige Stadion des FC Barcelona Camp Nou könnte bald Spotify Arena heißen. |Photo by Fikri Rasyid on Unsplash
Diese Misslage zeigen auch die Investitionen der Firma selbst. Neben 100 Mio. für Joe Rogan und anderen gut dotierten Verträgen mit anderen Podcaster*innen wie die Ex-Royals Harry Windsor und Meghan Markle kaufte das Unternehmen in den vergangenen Jahren primär im Bereich Podcast und Audio ein. Dazu gehören die Podcast-Producer Gimlet Media für 200 Mio. Dollar, die Sport-Webseite The Ringer, das Hörbuch-Unternehmen Findaway, die Podcast-Discovery-Plattform Podz und das Podcast-Vermarktungsunternehmen Megaphone (ehemals Panoply Media) für 235 Mio. Dollar. Ich möchte hier gar nicht per se gegen Podcast und Audio stänkern. Wir hören alle gerne Audio-Content, es gibt auch viele spannende Formate und tolle Geschichten darunter. Aber: Wenn über die vergangenen zehn Jahre tausende von Artists und Acts ihren Output vertrauensvoll in die Obhut einer Plattform geben und ihnen glorreiche Zukunft versprochen wird (immerhin wurde Spotify ja auch als Lösung gegen illegales P2P-Filesharing verkauft und platziert), dann fühlt sich das alles wie ein einziges Stockholm-Syndrom an. Da passt die Rhetorik von Daniel Ek gut ins Bild, als er 2020 mitteilte, dass es vielleicht auch an den Künstler*innen läge, wenn sie glaubten, es würde reichen, nur alle drei bis vier Jahre ein neues Album aufzunehmen. Let them eat cake.
Es wird auch zunehmend schwerer, über Alternativen zu diskutieren. Denn die Konkurrenz heißt Google, Apple und Amazon. Aber hier konsolidiert sich noch mehr Macht und Geld als bei Spotify, das im Vergleich zu den Digital-Monopolisten wie ein mickriger Fisch anmutet. Aber auch Plattformen wie Bandcamp sind strukturell den Prinzipien der digitalen Plattformökonomien unterworfen. Anders, es macht keinen Unterschied, wenn man statt bei H&M bei Supreme ein T-Shirt kauft, wenn es in der selben Fabrik hergestellt wird. Die Musikwelt muss lernen, sich unabhängig zu machen. Diskurse, das Schaffen von neuen Möglichkeitsräumen, wäre ein Beginn. Wenn schon niemand Geld verdient, dann doch wenigstens selbstermächtigt und nicht unterjocht von globalen Firmen, deren Investoren, a) nix für Musik übrig haben und b) Musik auch sui generis ja nichts ist, das sich durch Profit und Wachstum definiert. Niemand muss seine Seele verkaufen, die Allerwenigsten heißen Bob Dylan und können dicke Verlagsdeals an Land ziehen. Musik zu schaffen, bedeutet auch, Kontrolle darüber zu behalten. Dass über Erfolg und Misserfolg alleinig entscheidet, ob man heute in einer populären (Yoga- oder Workout-)Playlist stattfindet oder nicht, kann nicht im Interesse all jener Menschen sein, die so viel Zeit, Gefühle und Energie in ihre Songs und Alben stecken. Und nicht selten damit auch etwas sagen und bewirken wollen.

Keine Tantieme, schnell produziert, kurze Halbwertszeit. Das Unternehmen Spotify investiert hunderte Millionen in Podcasts und Audio. | Photo by Kate Oseen on Unsplash
Es klingt pathetisch, aber ich habe das Gefühl, dass es Zeit wird, dass Musiker*innen, Labels, Medien, aber auch Clubs sich neu zusammenfinden müssen. Eigene Strukturen und Infrastrukturen schaffen, die sich von der Gier globaler Plattformen wie Spotify, Amazon und Apple emanzipieren. Um es mit Gil Scott-Heron zu sagen: „The revolution will not be streamed“. Derzeit sehen wir keine Anzeichen, dass die Strategie von Spotify sich über die nächsten Jahre groß wandeln wird (siehe eben die Investitionen der vergangenen Jahre mit Fokus auf Podcasts, die sich ja erstmal rentieren müssen). Musik braucht eine Wirtschaft und eine Landschaft, die sich um die Belange des eigentlichen Sujets kümmert. Im 20. Jahrhundert war es noch die Tonträger-Produktion, auch hier gab es mit der Major-Industrie Strukturen, die nicht immer „musikalisch“ motiviert waren. Aber dennoch Erfolgsgeschichten von kleinen Labels ermöglichte, die unabhängig groß wurden und einen nachhaltigen Impact in der Popkultur hinterließen. Wie können ähnliche Narrative heute aussehen?
Auch wünsche ich mir eine Musikwelt, die vor allem jungen Musiker*innen aufzeigt, dass es stilistische Alternativen zu Rap gibt, wenn man sich eine Existenz aufbauen möchte und dass es faire Vergütungsmodelle gibt, die nicht nur den Großen in die Tasche spielt (Stichwort: Pro-Rata). Nicht jeder kann es sich leisten, eine eigene Eistee-Marke zu launchen. Genau das war ja einmal das Versprechen der Digitalisierung. Dass die Kultur vielfältiger und transparenter wird. Dass Qualität und tolle Talente sichtbarer werden und nicht hinter den immer gleich gekämmten Kachelwänden der Top-Streaming-Dienste verschwinden. Dass man als Artist auch keine E-Mails mehr von dubiosen Agenturen bekommt, die einem für Geld versprechen, in prominenten Playlisten platziert zu werden oder Plays auf Soundcloud zu generieren. Denn wen interessiert es eigentlich, dass ein Song eine Million Mal gehört wurde, wenn die Hälfte davon in Klickfarmen in Asien abgespielt wurde. Sollte man Musik nicht für Menschen schreiben statt für Maschinen?
In der Kultur ist es wie mit der Nachhaltigkeit. Fans, Artists, Labels, Medien, Journalist*innen und Veranstalter*innen können durch ihr eigenes Handeln etwas bewegen. Am Ende sind nämlich Spotify und Co. von uns abhängig. Ich rede hier nicht von tumber Cancel-Culture. Ich fordere auf, ernsthaft zu fragen: In was für einer Musikwelt wollen wir leben? Und war ein selbst organisierter Markt mit regionalen Produkten nicht immer schon besser als Wal-Mart, Aldi und McDonald’s?