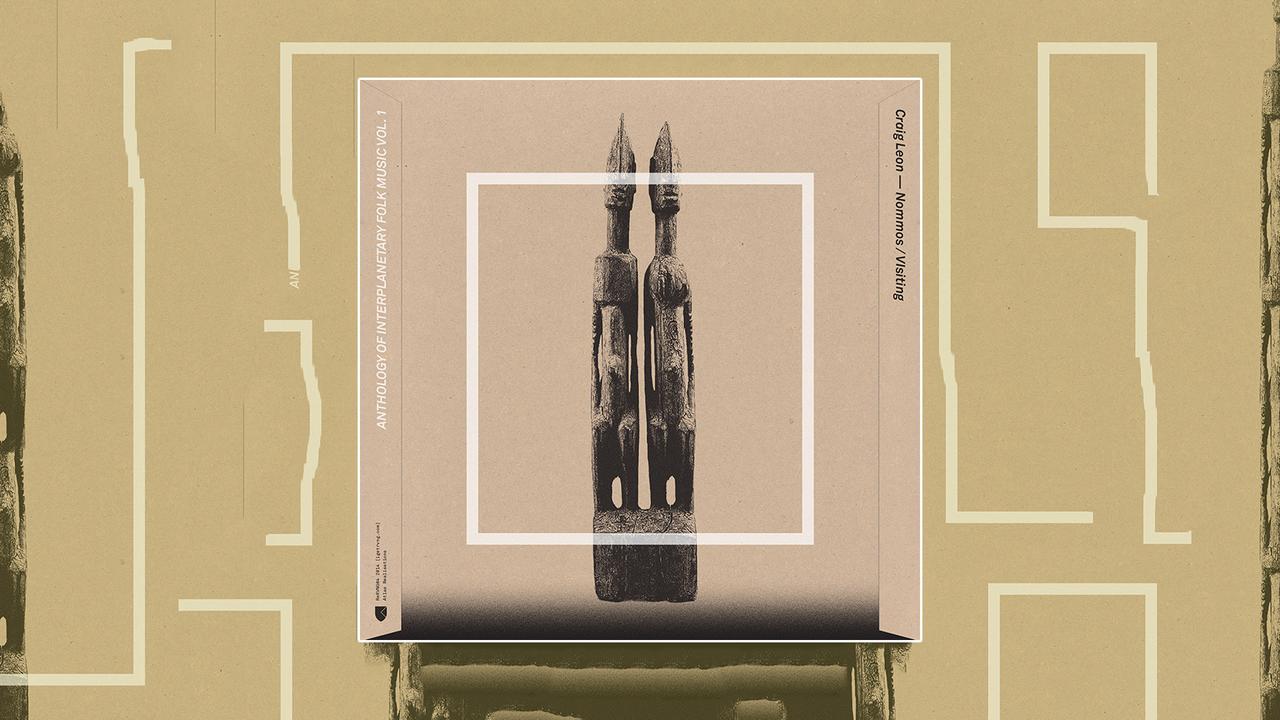„Ich bin kein Genie, aber muss so wirken!“Der housende Holländer Martyn speckt die Bassdrum ab
16.6.2014 • Sounds – Interview: Michael Döringer
Alle Bilder: MelDCole
Von Dubstep zu Techno und über House wieder zurück. Der Niederländer Martijn Deykers lässt sich musikalisch einfach in keine Schublade stecken. Zum Glück. Sein neues Album „The Air Between Words“ erzählt wundervoll inspirierende Geschichten des Bassdrum-Abspeckens. Four Tet und Inga Copeland haben ihm dabei geholfen.
Martijn Deykers ist seit Jahren eine feste, aber wandlungsfähige Konstante in der Clubkultur. Seine Künstler-Persönlichkeit ist zwar nicht annähernd so schillernd wie seine Musik, deshalb ist es auch halb so wild, dass ihr den Typen auf dem Foto hier vielleicht zum ersten Mal seht. Die Chancen stehen aber sehr gut, dass man diesem eher zurückhaltenden Niederländer als interessierter Basskadett oder passionierte Raverin schon mal begegnet ist. Wenn nicht live im Club oder auf einem Festival, dann mindestens unbewusst durch einen seiner Tracks oder Remixe, oder aber eine Platte, die auf seinem eigenen Label 3024 erschienen ist - zum Beispiel von Julio Bashmore, Jacques Greene oder Leon Vynehall. Nein, auch nicht? Dann ist jetzt definitiv die beste Zeit für ein Kennenlernen, denn Martyns gerade erschienenes Album „The Air Between Words“, sein drittes bisher, ist die einladendste, angenehmste und vielleicht konsequenteste Platte, die er bisher gemacht hat.
Einst stand der Name Martyn synonym für Dubstep - immerhin entstammt der Mann aus Eindhoven einer gewachsenen Drum-and-Bass-Szene und war für einige der interessantesten Produktionen Ende der Nuller Jahre verantwortlich, wie diese beiden Videos eindrücklich zeigen.
Broken, erschienen 2007
Natural Selection, erschienen 2008
Diese fast strenge Verbindung löste er 2011 mit seinem brillanten Album „Ghost People“ gekonnt auf, mit dem er sich selbst in alle elektronischen Himmelsrichtungen zerstreute. Seitdem darf er als etwas wie der Meister aller Rave-Klassen gelten, eine Bank in jedem Club dieser Erde. Und deshalb ist es so überraschend wie logisch, dass „The Air Between Words“ nun ein regelrechtes House-Album geworden ist. Und eines der besten in diesem Jahr obendrein, weil Martyn sich auf eine uralte Maxime besinnt, die viele Techno-Alben leider deutlich vermissen lassen: All killer, no filler. Es kann so einfach sein.
Du hast vor geraumer Zeit deine holländische Heimat verlassen und bist nach Washington D.C. umgesiedelt. Eine Stadt, die man am ehesten natürlich mit der US-Regierung verbindet und vielleicht noch mit Hardcore Punk - was hilft dir dort beim Produzieren?
Es ist schon ein merkwürdiges Fleckchen Erde. Man könnte es mit dem alten Bonn vergleichen, bevor Berlin wieder Hauptstadt wurde - keine besonders große Stadt und nicht viel los. Aber wenn man so viel herumreist, sammelt man genug Einflüsse unterwegs. Und hier habe ich vor allem Ruhe und Frieden, alles ist so aufgeräumt, dass ich mich auch komplett darauf konzentrieren kann, Musik zu machen. Die Ideen dazu bringe ich mit nach Hause.
Als DJ bist du aber vor allem in Europa unterwegs, oder hat sich das mittlerweile geändert?
Nicht wirklich, aber ich spiele schon öfter in den Staaten. Vor allem hat sich die Qualität der Gigs hier verbessert, das ist wirklich positiv. Die Clubszene wird immer ordentlicher, besonders in den größeren Städten. Da gibt es schon viele sehr solide Partys. Und die Leute sind extrem aufgeschlossen gegenüber einem neuen Sound.
Anders gesagt: In Europa herrscht doch bestimmt eine ganz andere Erwartungshaltung in den einschlägigen Clubs, wenn du angekündigt bist. Oder ist das ein schlimmes Vorurteil?
Es kommt immer drauf an, so pauschal kann man das nicht sagen. Wenn das Publikum weniger von dir erwartet, macht das dein Set auch nicht unbedingt einfacher. Manchmal habe ich tolle Nächte mit einer relativ ahnungslosen Crowd, die mich nicht kennt und einfach aufgeschlossen ist. Aber ich habe auch schon in London gespielt, wo die Leute dann offenbar auf bestimmte Tracks warten. Wenn die dann nicht kommen, wird es schwierig.
Und natürlich gibt es auch in den Staaten ein Expertenpublikum. Der Unterschied ist eher der, wie man hier clubben geht: In Berlin ist man diese 24-Stunden-Party gewohnt, zu jeder Uhrzeit geht etwas und die Leute haben ein gutes Durchhaltevermögen. Hier in den Staaten geht das alles viel schneller - außerhalb von New York und ein paar großen Städten machen die Clubs nämlich um 2 Uhr morgens dicht. Trotzdem geht man um halb 12 oder so aus, und dann ist das Ganze nach zwei Stunden fast schon wieder vorbei! Die Aufmerksamkeitsspanne ist also winzig, und deshalb muss man versuchen, in sehr kurzer Zeit etwas möglichst Eindrucksvolles abzuliefern. Und das kann sehr kompliziert sein.
Wo spielst du denn dann am liebsten?
Naja, das klingt vielleicht langweilig, aber es ist wirklich die Panorama Bar in Berlin. Vor allem wegen der Zeit, die man dort hat - man kann Dinge in einem Set entwickeln und Tracks spielen, mit denen ich sonst vorsichtig wäre. Und wenn es läuft, dann kann ich das auch woanders ausprobieren. Ich kann richtig experimentieren, deshalb mag ich es da. Aber manchmal kriege ich bei anderen Gigs auch die ganze Nacht - Zeit ist eigentlich das Wichtigste.
Du legst also wirklich gerne fünf Stunden am Stück auf?
Nur wenn der Club gut ist! Manchmal sind fünf Stunden die Hölle, auch, wenn man vielleicht keinen guten Tag erwischt hat oder so. Es hat nicht immer allein das Publikum Schuld. (lacht)


Dein neues Album erscheint nun nicht mehr bei Flying Lotus’ Brainfeeder-Label, sondern direkt beim Mutterunternehmen Ninja Tune. Doch selbst dort sticht die Platte heraus - Ninja Tune ist eine Bastion für Down- und Broken-Beats aller Art, „The Air Between Words“ ist aber ein amtliches Stück Dance Music. Wie kam es dazu?
Was für mich zählt: Sie haben Erfahrung, eine beeindruckende Historie mit tollen Platten und gerade in der letzten Zeit hat Ninja Tune einfach gute Arbeit gemacht. Und eigentlich definieren sie gerade ihr Label neu, um mehr zu sein als nur dieser alte Gigant aus den 90ern. Mit neuen Acts, wie z.B. Machinedrum oder Actress.
Absolut! Reden wir doch über das Album - anfangs dachte ich: Ja, tolle Tracks, aber wie gehören sie zusammen, was macht das alles zu einer LP? Irgendwann merkte ich, dass es eben kein klassisch strukturiertes Album ist, sondern eher wie ein starker, kohärenter Mix wirkt: ohne Lückenfüller, eine A-Seite nach der anderen.
Meine Arbeitsweise war dieses Mal auch eine andere, konkret habe ich die Auswahl der Stücke anders gehandhabt. Ich hatte 16 oder 17 Tracks, und ich wollte natürlich alles davon draufhaben - um meine Vielseitigkeit zu beweisen, du weißt schon: Ich kann’s deep, aber auch ein bisschen härter und so weiter. Zum Ende hin habe ich dann aber den ganzen überflüssigen Speck einfach entfernt - also alles, was als eine Art Zugabe gedacht war oder vielleicht eher die klassische B-Seite wäre. Am Ende blieben dann wirklich nur die starken Stücke übrig, die Filets. Es ist ja genau wie bei einem Steak: Wenn das ganze Fett dranbleibt, sieht es vielleicht größer aus, aber es kommt doch auf das Kernstück an.
Glassbeadgames hat Martyn gemeinsam mit Four Tet produziert und findet sich auf dem aktuellen Album.
Auch die Breakbeats sind fast komplett verschwunden. Alles ist beinahe durchgehend tanzbar und geradeaus - woher kommt dein neuer Spaß an fast reinrassigen House-Tracks? Und bezeichnest du die Tracks überhaupt auch so?
„Ich beginne eine Produktion immer mit der Melodie. Was dann für ein Beat dazukommt, entscheide ich später.“
Eigentlich nicht wirklich. Ein Track beginnt für mich normalerweise mit einer melodischen Idee, und danach formuliere ich diese Idee ganz aus, bevor ich die Beats und den Bass drum herum baue. Dann sehe ich auch erst, was Sinn macht - manche Melodien passen einfach besser auf einen Breakbeat als zu einem House-Rhythmus, manchmal ist es umgekehrt, und manchmal macht ein Beat nur alles kaputt. Entsprechend war die neue Platte auch nicht als House-Album „geplant“, es ist einfach passiert. Natürlich ist man immer stark beeinflusst von anderer Musik, und im Moment passieren in der Welt von House und Techno sehr viel spannende Dinge, es ist wieder richtig innovativ gerade. Das gilt zwar auch für manche Breakbeat-Produktionen, aber solche Sachen verweisen mir oft zu sehr auf die Vergangenheit. Da werden meist nur die 90er wieder aufgewärmt, und viel zu selten versucht mal jemand, dem eine neue Facette hinzuzufügen.
Und darum geht es mir ganz und gar nicht, ich wollte auf keinen Fall eine Art Retro-Album machen. Klar, House klingt immer ein bisschen retro, weil diese Musik eigentlich durchgehend seit Jahrzehnten am Start ist. Mag sein dass das Album alt klingt, aber auf keinen Fall retro!
Niemals, es klingt nach einer sehr zeitgemäßen Variante.
Und das ist das Beste: Wenn man trotzdem gleichzeitig ganz entspannt auf alte Ideen verweisen kann - es fällt ja auf, dass ich zum Beispiel alte Warp-Sachen aus den 90ern mag, wie LFO, die frühen Autechre oder Polygon Window. Ich liebe diesen UK-Sound von damals: B12 oder Stasis. Auf sowas stehe ich, denn das ist melodischer Techno. Man hört das vielleicht in manchen Tracks auf dem Album, dass ich solche Ideen verbauen wollte, ohne meine Zeitgenossenschaft aufzugeben. Ich wollte die alten Sounds also viel mehr neu interpretieren, anstatt sie bloß zu kopieren.
Du hast auch eine sehr coole Form der Zugänglichkeit erreicht. Es ist wohl viel schwerer, den Tracks eine Form von mass appeal mitzugeben, als sie auf möglichst experimentelle Weise zu dekonstruieren?
Wie passend: Ich habe gerade ein Buch über Leonard Cohen gelesen, und darin stand ein Zitat von irgendeinem alten Dichter, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und der sagte in etwa: „It’s genius to make something that communicates before it’s understood.“
Genau das meine ich!
Man macht also etwas aus dem Herzen heraus, das für alle funktioniert, bevor sie überhaupt verstehen, was genau man macht. Vielleicht geht das auch zu weit für meine Musik. Aber die Idee finde ich gut: Referenzen etwa zu Techno aus den 90ern auszumachen, das wäre sozusagen das Verstehen der Musik. Aber viel wichtiger für gute Musik ist doch, dass auch diejenigen davon begeistert sind, die keine Ahnung haben, wie Autechre einst klangen. Und wenn du diesen Punkt erreichst, an dem Leute ohne großes Fachwissen deine Musik mögen, dann hast du etwas Großes geschafft. Das passiert hoffentlich an manchen Stellen meines Albums. Um noch mal auf das Zitat zurückzukommen: Ich halte mich natürlich nicht für ein Genie, aber eine solche Wirkung muss doch das Ziel sein!

Auch beim Auflegen musst du schließlich versuchen, das ganze Publikum zu kriegen. Hat dein DJ-Dasein nicht auch direkten Einfluss auf deine Produktionen?
„Seit ich wieder vermehrt mit Schallplatten auflege, bin ich viel ruhiger. Weniger Tricks, mehr Zen. Das schlägt sich auch in meinen eigenen Tracks nieder.“
Musikalisch weniger, eher in einer bestimmten Back-to-Basics-Herangehensweise. Ich habe früher mit Serato aufgelegt, und ich finde, mein Stil war damals sehr nervös und abgelenkt: zu viele verschiedene Styles und Genres, total unterschiedliche Tempi. Meine Sets waren kurz und hektisch. Und seit ich wieder größtenteils mit Platten und ein paar neueren Sachen auf dem USB-Stick auflege, merke ich, dass ich viel ruhiger geworden bin hinter den Decks: Man lässt die Platten für sich selbst sprechen, gibt ihnen Zeit sich zu entwickeln, und die Leute können die Musik genießen - die brauchen meine fancy Mixeinlagen gar nicht. Für mich ist es viel mehr Zen geworden. Das war auch meine Herangehensweise auf dem Album: Ich lasse die Tracks für sich sprechen und einfach laufen, anstatt zu versuchen, sie übertrieben aufregend zu gestalten, damit jede Minute etwas anderes passiert. Manche Tracks sind großartig, wenn man sie einfach zehn Minuten laufen lässt. Wenn ich also „Ghost People“ mit der neuen Platte vergleiche, dann ist Letztere viel mehr Zen. „Ghost People“ wollte zu viel auf einmal, ist zu bemüht geraten.
Das neue Album hat aber trotzdem verschiedene Seiten - ein ganz wunderbarer Song ist zum Beispiel „Love Of Pleasure“ mit den Vocals von Inga Copeland. In einer gerechten Welt wäre das ein Charthit. Wie kam eure Zusammenarbeit zustande?
Wir haben uns auf ein paar Hyperdub-Partys kennengelernt, bei denen wir gespielt haben, sie mit Hype Williams. Ich wusste, dass sie auch solo Musik macht, und so haben wir angefangen, Skizzen und Demos auszutauschen. Einfach um herauszufinden, ob wir uns vielleicht gegenseitig unterstützen könnten. Unsere Produktionen sind zwar sehr unterschiedlich, aber irgendwie lassen sie sich sehr gut verschmelzen - meine Sachen sind ja eher melancholisch und warm, und ihre fragile Stimme schwebt absolut wunderbar darüber. Wir haben noch viele andere Songs gemacht und planen gerade ein Live-Set zusammen. Die Songs daraus werden bestimmt auch noch veröffentlicht. Die Live-Shows machen mir am meisten Spaß. Bisher habe ich immer nur allein gespielt, und jetzt merke ich, wie toll so ein Jam zu zweit ist. Man ist dann nicht immer für alles allein verantwortlich - du darfst Lücken lassen, denn dein Partner ist da, um sie aufzufüllen.
Martyn, The Air Between Words, ist auf Ninja Tune erschienen.
Bei Amazon oder iTunes kaufen