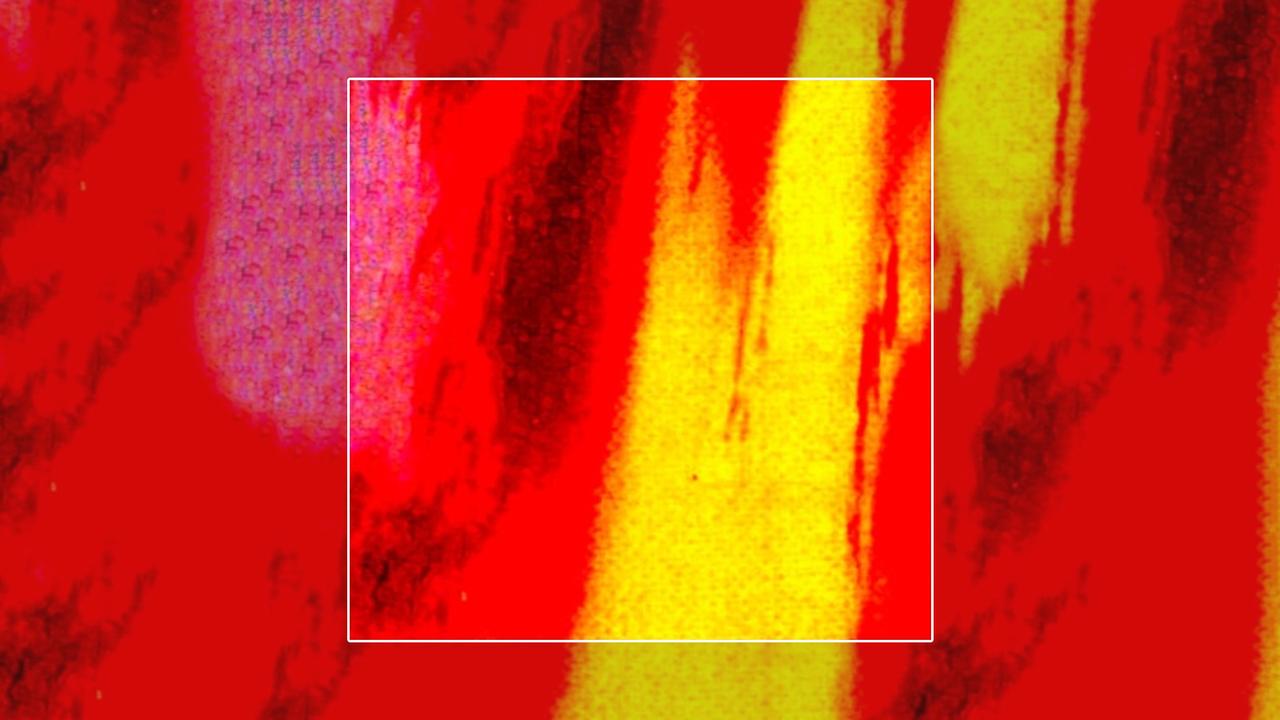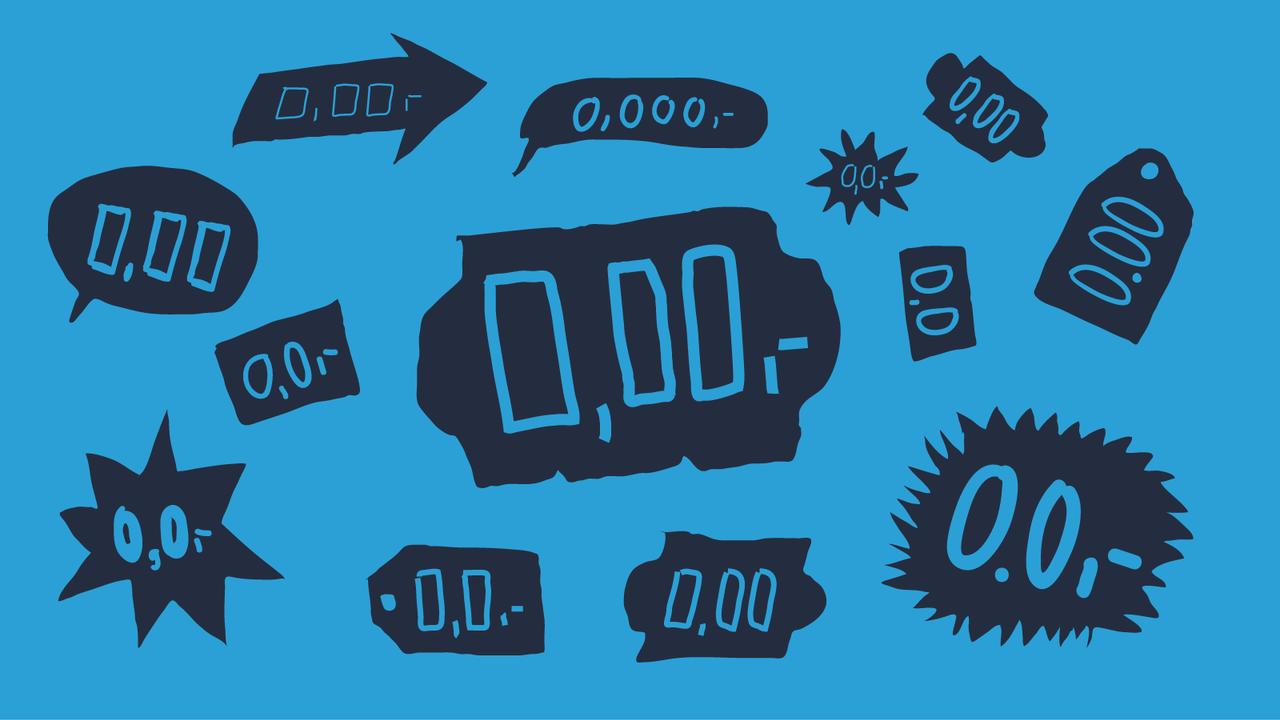„Die Techno-Szene ist zu weiß und heterosexuell“Helena Hauff im Interview
2.9.2015 • Sounds – Interview: Ji-Hun Kim
Foto: Katja Ruge
Die Hamburger Musikerin Helena Hauff wurde vor einigen Jahren als Resident-DJ im Golden Pudel Club bekannt und gilt heute als eine der geachtetsten und kompromisslosesten Künstlerinnen und DJs im elektronischen Music-Circuit. Auf dem Actress-Label Werkdiscs erscheint dieser Tage ihr lang ersehntes Debütalbum „Discreet Desires“. Eine Schallplatte, die nach monochromer Filmkunst des beginnenden 20. Jahrhunderts, modrig-düsterer Sehnsucht und Wave schmeckt. Ein eigenwilliger, wie konsequenter Sound, der jede noch so kleine, schmutzig klingende Roland-Acid-Modulation einer perfekt-digitalen Ableton-Big-Band vorzieht und dabei immer verschroben-dark und enigmatisch-romantisch bleibt. Das Filter traf Helena an einem grauen Sommerregentag zum Interview und sprach mit ihr über ungewollte Selfies, Chartpop-Aversionen, Zeitreisen gegen das Rauchverbot und Sexismus in der Techno-Szene.
Erzähl mir, wie ist das Album entstanden?
Vor zehn Jahren habe ich mal ein Foto gemacht. Nach einiger Zeit habe ich dieses Bild dann wieder entdeckt und beschlossen: Das soll mal ein Cover werden. Das Bild stand für mich aber weniger für Acid. Ich dachte eher an Melodien, es sollte dark und wavig sein. Also fragte ich mich, wie die Musik zu diesem Foto klingen könnte. Dann passierte lange Zeit erstmal gar nichts. Irgendwann saß ich im Studio, arbeitete an einer Nummer und dann fiel mir plötzlich dieses Foto wieder ein. Daraus wurde das erste Stück und Schritt für Schritt wurde ein Album daraus. Allerdings, als ich so gut wie fertig war, entdeckte ich auf einmal ein anderes Foto in meinem Archiv. Das passte plötzlich viel besser zu dem Album als das erste. Also wurde die ursprüngliche Cover-Idee komplett umgeworfen (lacht).
Das bist du schon selbst auf dem Cover, oder?
Ja.
Ein Selfie.
Ja, es ist ein Selfie. Aber gab es das Wort vor zehn Jahren schon?
Ich glaube, eher nicht.
Aber daran musste ich kürzlich auch denken. Festzustellen, dass das Foto im heutigen Sprachgebrauch ein Selfie ist, damals sagte man noch Selbstportrait …
Du hast dich intensiver mit Fotografie beschäftigt?
Ich habe früher viele Fotos gemacht. Ich habe auch mal zwei Jahre Kunst studiert und in der Zeit ist ein Großteil meiner Bilder entstanden. Dann stellte ich aber fest, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Ich habe dann das Kunststudium abgebrochen und Physik und Musikwissenschaften studiert.
Was hat dich an der Kunst gestört?
Ganz einfach. Ich wollte keine Künstlerin werden. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber so richtig als Künstlerin habe ich mich nie gesehen. Ich erinnere mich an eine Professorin, die zu uns sagte, sie würde umgehend mit der Kunst aufhören, würde sie nicht dieses dringende Bedürfnis verspüren, Kunst machen zu müssen. Sie meinte: „Ey, wenn ihr das jetzt nicht unbedingt machen müsst, lasst es! Es ist die Hölle. Es ist Stress, es bringt kein Geld, es nervt, du musst dich mit scheiß Galeristen rumschlagen …“ Das leuchtete mir ein. Wieso etwas machen, das man nicht aus innerer Kraft machen muss? Ich habe hier und da ein Bild gemalt, das fand ich ganz OK, ein bisschen Theorie dazu – natürlich hat sich die Künstlerin dabei auch was gedacht (lacht). So in etwa war das mit der bildenden Kunst und mir.
Bei der Musik ist das anders?
Als ich Musik für mich entdeckte, war plötzlich alles anders. Das war etwas, das ich unbedingt machen wollte.
„Fröhliche Radio-Hits machen mich aggressiv. Wenn ich im Taxi sitze und der Fahrer hört auf voller Lautstärke Radio und da laufen diese furchtbaren, fröhlichen, chartigen Sachen – Ich könnt mir die Ohren zuhalten und anfangen zu heulen.“
Es gibt den bekannten Satz von Arnold Schönberg: Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen. Wie sieht bei dir das Bedürfnis aus, Musik ergo Kunst machen zu müssen? Oder ist es doch ein Handwerk?
Eine schwierige Frage. Ich sehe es nicht als reine Dienstleistung, dafür ist es zu eigen. Ich würde es aber auch nicht als Kunst-Kunst bezeichnen, weil es ja auch Entertainment ist. Für mich zumindest. Mir ist es wichtig, die Leute zu unterhalten. Ich spiele prinzipiell nur Musik, die ich mag. Daher ist mein Ideal, dass die Leute, die in den Club kommen, auch genau das hören wollen und Spaß dazu haben (lacht).
Apropos Spaß. Es hieß mal du magst keine fröhlichen Radio-Hits.
Fröhliche Radio-Hits machen mich aggressiv. Das macht mich wahnsinnig. Wenn ich im Taxi sitze und der Fahrer hört auf voller Lautstärke Radio und da laufen diese furchtbaren, fröhlichen, chartigen Sachen – Ich könnt mir die Ohren zuhalten und anfangen zu heulen. Ich ertrag es einfach nicht. Das gilt aber auch für Underground- und Indie-Sachen, die einfach nur fröhlich sind. Es sind also gar nicht die Stile oder Genres sondern viel mehr die Harmonien und Melodien, die mich so fertig machen.
Das macht dich also körperlich richtig fertig.
Total. Ich empfinde diese blanke Fröhlichkeit als etwas sehr Aggressives. Aber da gibt es auch Schlimmeres und weniger Schlimmes.
Wo ist da deine Grenze? Die Grenze zwischen fröhlich und traurig/deprimierend dürfte bei den meisten individuell verlaufen. Es gibt Bands, die finden einige normal bis optimistisch und andere würden dabei aus dem Fenster springen.
Genau. Für mich ist darke Musik am Ende fröhliche Musik. Weil darke Musik mich glücklich macht. Wenn happy Chartpop mich unglücklich macht, dann ist das für mich traurige Musik.
Hast du dich je gefragt, woher das kommt?
Durchaus. Ich glaube, was mich daran stört ist, dass es sich so feige anfühlt. So, als sei es nicht echt. Dieses Spiel mit Maskeraden, dieses Kaschieren. Da wünsche ich mir lieber Ehrlichkeit, auch wenn das jetzt ein großer Begriff ist. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes und ich höre einfach anders als der Rest.
Musikkulturell sind da die Wahrnehmungen in der Tat verschieden. Nicht überall auf der Welt stehen Moll-Akkorde für etwas Trauriges. Aber wenn du von Authentizität und Ehrlichkeit sprichst, reflektiert dunkle Musik für dich auch eher die Welt wie sie ist? Sie ist oft nicht so bunt und schön, wie man sich das gerne wünscht.
Ich kann da schon abschalten. Wenn ich am Strand ein Bier trinke, dann trinke ich am Strand ein Bier. Allerdings interessiert es mich schon, was in der Welt passiert. Ich lese viele Bücher, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Es beschäftigt mich, aber es macht mich jetzt nicht fertig. Ich bin schon ein melancholischer Mensch, aber kein trauriger Mensch. Eigentlich bin ich glücklich und ich habe auch keine Angst, was ich wichtig finde. Angst wird ja in Zeiten wie heute gerne instrumentalisiert. Ich empfinde Angst als etwas Falsches.
Es geht dabei ja auch um Kontrolle.
Ja, aber auch sich nicht beeinflussen zu lassen.
Und das geht dann …
Indem man richtig darke Musik hört (lacht).

Foto: Katja Ruge
Was ist die darkste Musik, die du je gehört hast?
Es gibt eigentlich keine Platte, die zu dark ist. Ich stehe aber nicht so auf das Emo-Zeug, wenn in der Musik zu viel gelitten wird. Es gibt aber Musik, die mich sehr packt. Wo ich denke: Fuck, das ist ganz schön hart. Es gibt ein Stück von Flo & Andrew, „Japanese Girls“ von der Platte „Take Suicide". Da ist etwas an der Nummer, das finde ich hart. Es löst etwas in mir aus. Ich weiß nicht was und warum. Manchmal passiert so was und manchmal nicht. Aber „Japanese Girls“ ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsstücke.
Wie geht dein musikalischer Ansatz mit dem allgemeinen Club-Business zusammen? Du bist viel unterwegs und der Großteil der globalen Clubkultur fokussiert sich am Ende dann doch auf das Abschalten vom Arbeitsalltag. Wenn die Woche schon scheiße ist, dann kann ich wenigstens am Wochenende die Sau raus lassen, für ein paar Stunden ein Happy Life haben.
Der Großteil der Leute macht ja auch genau das. Es gibt ja die zahlreichen einschlägigen Discos, wo genau das gespielt wird. Sei es Schlager oder auch Chartmusik. Ich finde ja, die Szene, von der wir sprechen, ist ziemlich klein. Aber offenbar gibt es da draußen Menschen, die ähnlich ticken wie ich und so kann man ich eben die Musik spielen, die ich mag.
Aber selbst Theo Parrish wurde angeblich vom DJ-Pult der Panorama Bar verscheucht, weil er zu „publikumsunfreundlich“ gespielt hätte.
Echt jetzt?
Auch in der sogenannten Techno/House-Szene gibt es offenbar Toleranzgrenzen. Ist dir so etwas nie passiert?
Eher nicht, wobei einmal ist mir so was passiert. Ich war zu der Zeit noch nicht lange DJ, da wurde ich auf ein Open-Air gebucht. Die Leute liefen mit Glitzer im Gesicht herum. Es wurde eher seichter Techhouse gespielt. Davon wusste ich aber nichts und habe mich wie immer vorbereitet. Ich habe nur ein paar Platten gespielt, bis jemand kam und nur meinte: Nächster DJ. Danach konnte ich gehen.
So hart gleich?
Nach der zweiten Platte kam er an und wollte wissen, ob ich nicht was anderes spielen könne. Als ich entgegnete, das ginge nicht, stand der nächste DJ quasi schon hinter mir (lacht). Das Publikum hat das aber auch nicht verstanden. Da waren Leute, die haben mich beschimpft. Ein Mann blaffte mich an: „Ey, checkst du nicht, wie scheiße das klingt?!“ Am Ende war ich froh, mich nicht weiter von diesem Typen anbrüllen lassen zu müssen. Das war aber eine Ausnahme. Klar, gibt es Clubs und Partys, bei denen passt es besser und bei anderen ist es schwieriger. Aber das gehört dazu.
Bist du ein moderner Mensch?
Ja. Ich denke, ich bin ein moderner Mensch, frage mich aber auch, was modern heutzutage bedeutet. Ich bin froh, dass ich heute lebe und nicht vor 30 Jahren – vor 20 Jahren zu leben wäre vielleicht noch OK. Ich finde nicht alles cool, was heute passiert. Denke aber, dass ich in der Lage bin, einen eigenen Weg zu gehen. Einige Sachen sind dabei vielleicht eher oldschool. Zum Beispiel mit Platten aufzulegen, mit Synthesizern Musik zu machen und weniger am Computer. Bargeld dabei zu haben, statt Kreditkarten, kein Smartphone zu haben. Dennoch mag ich die Zeit, in der wir leben ganz gerne, so lange man drinnen rauchen darf.
Das wird immer schwieriger mit dem Rauchen. London, New York …
Oder in Australien. Ich weiß. Das ist ein Problem. Wenn es irgendwann so sein sollte, dass man wirklich nirgendwo mehr rauchen darf, dann würde ich mir vielleicht wünschen, in den 50ern zu leben (lacht). Aber nochmal: Ich mag Fortschritt, ich mag Modernität. Aber bei Fortschritt muss man aufpassen, dass es nicht in die falsche Richtung geht. Nicht jeder Fortschritt ist ein Fortschritt. Am Ende geht es aber auch um eine eigene, persönliche Richtung. Und sei es, dass ich für mich entscheide, nicht mit einem Laptop aufzulegen. Aber hierbei gibt es ja bekanntlich weder richtig noch falsch.
„Ich mag Fortschritt, ich mag Modernität. Wenn es aber irgendwann so sein sollte, dass man nirgendwo mehr rauchen darf, dann würde ich mir wünschen, in den 50ern zu leben.“
Ich dachte eher, du würdest die Zukunft, den Fortschritt weniger optimistisch sehen.
Wieso?
Naja, dein neues Label nennt sich ja auch „Return to Disorder“?
(Lacht) Ja genau. Zukunft, hey, super!
Ein bisschen Punk und Anarchismus schwingt da ja doch mit.
Naja, es ist aber jetzt auch nicht so, dass ich mir wünschte, die ganze Welt ginge in die Luft. Ich hatte mal eine Platte mit dem selben Namen bei Panzerkreuz Records, einem Sublabel von Bunker Records, releast. Die Platte kam 2014 heraus, 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Nach dem Krieg gab es eine kleine, unbedeutende Kunstbewegung, die sich „Return to Order“ nannte. Ich hatte mich mal mit Futurismus und ähnlichen Strömungen beschäftigt und wollte, dass die Platte vom Namen her mit dieser Ära assoziiert ist. Ich spiele dann mit solchen Themen, betreibe Brainstorming, hab dabei jetzt aber keine konkrete Message. Ich will mit den Platten ja nichts sagen. Auf jeden Fall gab es diese Kunstbewegung, die eher konservativ und figurativ gewesen ist. Man wollte alte Ordnungen wieder herstellen. Daraus ist dieses Wortspiel entstanden. Und aus dem Plattentitel wurde am Ende der Name meines Labels. Da ich auch mal chaotisch bin, dachte ich, das passt ganz gut.
Und da gibt es ein erstes Release?
Die Platte kommt wahrscheinlich diesen September heraus. Eigentlich wollte ich früher damit raus. Am Ende wurde es aber ein längerer Prozess als gedacht.
Es ist aber keine Techno-Musik.
Nein, es handelt sich um eine Band aus England. „Children Of Leir“, die haben zwar eine Drummachine und einen Synthesizer, sind aber eigentlich eine Gitarrenband.

Foto: Katja Ruge
Und mit dem Label hast du langfristige Pläne?
Schon. Ich habe im Moment einfach große Lust drauf. Ich kenne tolle Leute, die tolle Musik machen, die ich gerne veröffentlichen würde. Ich stoße immer wieder auf Musik, bei der ich denke: Das hättest du doch gerne releast. Oder aber auch Tracks, die ich mache und auf keines der Labels passt, bei denen ich sonst veröffentliche. Mal gucken, wie es läuft. Vielleicht habe ich nach einem Jahr auch kein Bock mehr. Ich verspreche nichts, aber ich möchte das ausprobieren.
Ein Thema, das in letzter Zeit immer wieder diskutiert wird, ist Sexismus in der Techno-Szene. Wie würdest du als Protagonistin die Situation umschreiben?
Ich muss sagen, dass ich persönlich selten damit konfrontiert wurde. Ich wurde nie direkt angefeindet und wenn, dann kamen Dinge von Menschen, die nichts direkt mit der Szene zu tun haben – wie der eine Typ vom Festival, der mich angeschnauzt hat. Ich kann dabei aber nicht mal sagen, ob das jetzt sexistisch war oder nicht. Im Pudel ist mal was passiert, und zwar habe ich mit einer Freundin aufgelegt und da waren wohl zwei Typen an der Bar – ich selber habe erst später davon erfahren – die meinten wohl: „Oh nee, da legen zwei Weiber auf. Lass mal wieder gehen.“ Das ist natürlich bescheuert. Das sind aber Menschen, die auch außerhalb eines Techno-Clubs sexistisch sind. Ich würde sagen, dass es weniger ein Techno-spezifisches Problem als vielmehr ein allgemein gesellschaftliches ist. Sexismus existiert einfach in dieser Welt. Warum auch immer.
“Wenn man einen Job hat, in dem das Präsentieren auf der Bühne eine Rolle spielt, wie eben beim Auflegen, dann hat man als umwerfend gut aussehende Frau wie Nina Kraviz natürlich ein Problem. Ich finde das aber richtig scheiße.“
Man hört immer wieder Stimmen, die sagen, eine Nina Kraviz oder auch Helena Hauff sind nur so erfolgreich, weil sie so gut aussehen.
Das meine ich ja. Das sind aber die selben Stimmen, die schimpfen, wenn angenommen eine gut aussehende Frau Vorstand bei der Deutschen Bank wird. Sie wird das Gleiche zu hören bekommen und mit den gleichen Vorurteilen zu kämpfen haben. Wenn man einen Job hat, in dem das Präsentieren auf der Bühne eine Rolle spielt, wie eben beim Auflegen, dann hat man als umwerfend gut aussehende Frau wie Nina Kraviz natürlich ein Problem. Ich finde das aber richtig scheiße. Es ist ätzend und ich frag mich, was das soll.
Mir geht es auch darum, dass die Ursprungsidee einer inklusiven und gleichberechtigten Techno-Kultur immer mehr in den Hintergrund gerückt ist.
Ich habe mit anderen auch solche Gespräche geführt und wir sind immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass die Techno-Szene von heute zu heterosexuell und zu weiß ist. Der Ursprung der Techno-Szene war ja schwul und schwarz. Das ist natürlich verkürzt gesagt, zumal es schon in Chicago Typen gab, die tumbe Musik mit sexistischen Inhalten gemacht haben. Mein Wunsch wäre, dass es einfach egal ist, ob da oben eine Frau oder ein Mann als DJ steht. Ob schwul, hetero, weiß, schwarz oder was auch immer. Dass Leute sagen, es ist egal, weil es kommt auf die Musik an. Das war ja mal die Ursprungsidee.

Helena Hauff - „Discreet Desires“ erscheint auf Werkdiscs/Ninja Tune