No Bullshit, no GassenhauerSo war das Konzert von Depeche Mode in Berlin
17.3.2017 • Sounds – Text & Fotos: Thaddeus Herrmann
Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „Spirit“ spielte Depeche Mode einen intimen Gig im Berliner Funkhaus. Auch wenn die Nähe zwischen Band und Fans alle Beteiligten gleichermaßen irritierte: Je kleiner die Halle, desto größer die Faszination.
Martin Gore hat die Flügel abgelegt.
Als nach ziemlich genau 60 Minuten alles unwiderruflich vorbei ist, das Saallicht wieder angeht und der minimale Schranz-Acid wieder die Oberhand im Berliner Funkhaus hat, stupst uns die Frau neben uns an und animiert uns zum Mitgröhlen. Das kann es doch wohl noch nicht gewesen sein, sagt sie, da muss doch noch was kommen. Kommt es aber nicht. Depeche Mode sind im Backstage verschwunden, ohne Zugabe, ohne „Everything Counts“, ohne „Never Let Me Down Again“. Das gab es nicht mehr seit 1987.
Die größte Band der Welt spielt zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „Spirit“ eine Show im für ihre Verhältnisse wahrscheinlich kleinsten Venue seit Jahrzehnten. Während andere Musiker voller Euphorie ein Häkchen auf der persönlichen Checkliste setzen würden nach einem Konzert im ehemaligen Sendesaal des Rundfunks der DDR, diesem unfassbaren Raum, in dem Ende vergangenen Jahres schon Jóhann Jóhannsson zu verzaubern wusste, läuft das bei Depeche Mode wohl eher unter der Kategorie „Promo-relevanter Club-Gig“. Die Welt schaut online mit, in 360° und 4K. Wer eine Karte gewonnen hat und im Pit sein iPhone hochhält, um zu dokumentieren, was man so nie wieder erleben wird, ist im Himmel. Die bessere Sicht auf die Gemengelage der Bühne hat man aber wohl auf der Couch.

Depeche Mode ist nicht nur eine Institution, sondern auch ein Schweizer Uhrwerk. Wer die Band verfolgt, immer wieder zu den Konzerten geht, für den rückten Martin Gore, Dave Gahan und Andrew Fletcher – wie immer live unterstützt von Peter Gordeno an den Synths und Christian Eigner am Schlagzeug – weiter und weiter in die Ferne. Es gibt keine Halle oder kein Stadion, das die Band nicht füllen könnte. Das beeinflusst den Habitus, die Chemie und die Show. Ist etwas weit weg, werden die Arme immer und immer länger. Im Berliner Südosten ist einem die Band so nahe, das es schon fast unheimlich ist. So ganz geheuer scheint das den Musikern auch nicht zu sein. Das Phänomen Depeche Mode auf so ein Setting wie hier in Berlin herunter zu brechen, ist nicht ganz einfach. Distanz gibt Sicherheit. Nähe verursacht Irritation.
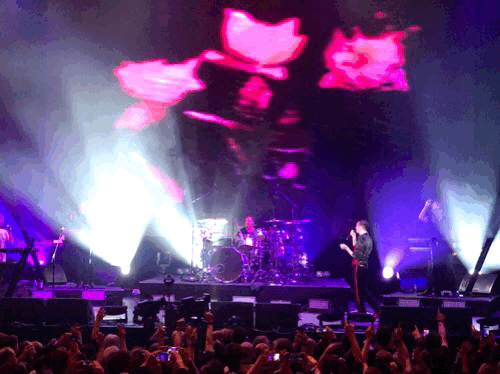

Aber Depeche Mode wären nicht Depeche Mode, wenn sie das nicht professionell wegspielen würden. Immerhin haben sie mit „Spirit“ ein Album veröffentlicht, das durchaus bemerkenswert ist. Vier Jahre nach „Delta Machine“, dem mit Abstand schlechtesten Album aller Zeiten der Gang aus der Londoner Schlafstadt Basildon, ordnet „Spirit“ Dinge neu, die dringend neu geordnet werden mussten. Die Schere zwischen elektronischem Erbe, Interesse an Rock – und in Daves Fall auf dem Roll – und dieser vermaledeiten Sucht nach Modularsystemen, halbgaren Basslines und unfassbar dämlichen Remixen war zu weit auseinandergegangen.
Zwar ist „Spirit“ eine über Strecken sehr selbstverliebte Referenzmaschine, so aber immerhin aber auch eine Art Best-of der eigenen Geschichte und all dem, was seit 1980 um die Band herum passierte. Die Songs sind besser. Das ist Fakt. Über die Produktion lässt sich streiten. Wie immer. Wer aber nicht zustimmt, dass sich die Band bei „So Much Love“ selber sampelt – ein Novum, bisher „verboten“ – und den epischen Filter-Sweep von „Any Second Now (Altered)“ von anno 1981 wieder einsetzt und bei „No More“ nicht das Intro von „The Black Hit Of Space“ von The Human League borgt, werfe den ersten Stein auf Dave Gahan, der sich wie immer die Eier krault und mit dem Popo wackelt.


Martin Gore hat also die Flügel abgelegt. Und kommt im Schlabber-Shirt auf die Bühne, wechselt bei jedem Song die Gitarre und macht sein Ding. Dave auch. Um Andrew Fletcher muss man sich langsam ein bisschen Sorgen machen, der hat den Groove verloren. Zu tun hat er bei Gigs ja eh nichts. Armer Kerl. Könnte auch im Liegestuhl am Bühnenrand sitzen und Zeitung lesen.
„Heute Abend sind einige Dinge der Depeche-Mode-Maschine fundamental anders.“
Das Konzert von Depeche Mode im Berliner Funkhaus ist dennoch bemerkenswert. Wenn man der Band wirklich mal so nah sein kann, fallen die Details auf, die in den Stadien der Welt einfach verloren gehen. Die Musikgruppe, die einst für ihren Synthpop verhöhnt wurde, sich dann am eigenen Schopf aus der süßen Scheiße gezogen hat, ist eine wirklich tighte Rockband geworden. Die solche Gigs auch dazu nutzt, Tracks zu spielen, die noch nie auf der Playlist standen („Corrupt“) und auch mit alternativen Versionen ihrer größten Hits experimentiert („A Pain That I’m Used To“). Das ist gut und wurde hoffentlich genauso für die anstehende Welt-Tournee protokolliert. Jeder Harcore-Fan der Band weiß, an welcher Stelle in welchem Song Dave Gahan welchen Kreischer rauslässt (es sind immer die gleichen), an welchen Stellen der den Monster-Schlagzeuger Christian Eigner anhimmelt und anspricht (auch das sind immer die gleichen) – Depeche Mode ist eben ein Uhrwerk, eine verlässliche Bank, die ein Gefühl des berechenbaren Zusammengehörigkeitsgefühls auf Knopfdruck liefert. Aber an diesem Abend sind einige Dinge fundamental anders. Und es ist schön, dass es so etwas noch gibt, geben kann.
Es wäre noch schöner, wenn die Band sich dazu durchringen würde, eine Tour in genau solchen kleinen Hallen zu spielen. Wenn sie auf die Stadien scheißen würde und dafür lieber für eine ganze Woche in den Städten gastierte, in denen ihnen die Fans ohnehin aus der Hand fressen. Berlin ist für Depeche Mode ja sowieso jenseits von Gut und Böse: Hier wurden die Jungs aus Essex erwachsen, hier haben sie ihre prägenden LPs gemischt. Dass das nicht umsetzbar ist, ist schade. Es könnte die Band erneut dazu befähigen, sich am eigenen Schopf aus dem rockistischen Sumpf zu ziehen.
Schön wäre auch gewesen, hätte sich Martin Gore zur Halbzeit der Show dazu hinreißen lassen, „Eternal“ zu singen, seinen vielleicht besten Song seit „Here Is The House“ anno 1986. Aber dazu kommt es nicht. Immerhin spart sich die Band auch „Just Can’t Get Enough“. Dafür muss man einfach dankbar sein: Das Funkhaus in Berlin ist kein Ort für Gassenhauer.









