Humanity firstBuchrezension: The War On Normal People von Andrew Yang
23.1.2019 • Kultur – Text: Jan-Peter Wulf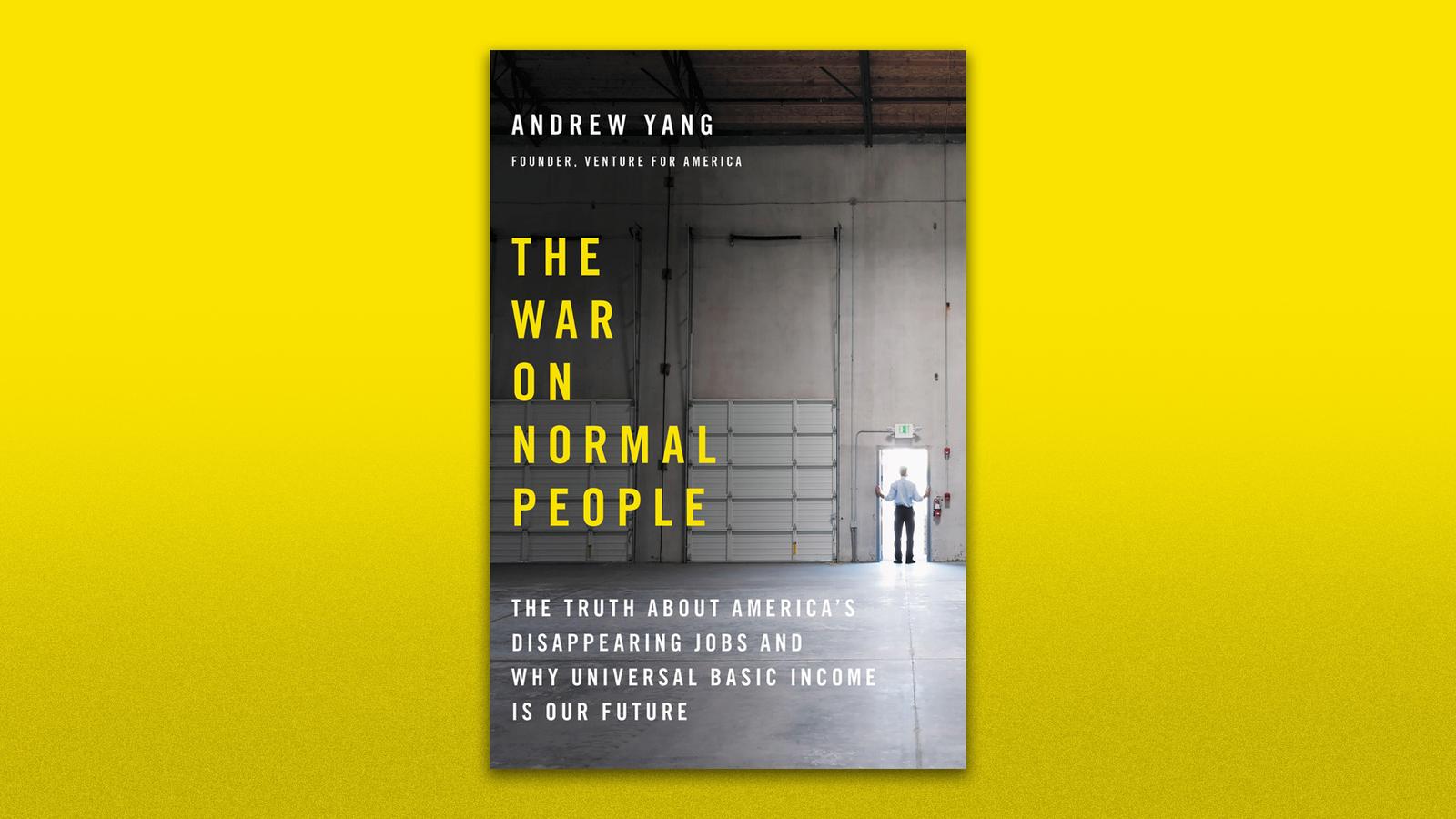
Asiatisches Einwandererkind, Schulnerd, Entrepreneur-Ikone und jetzt demokratischer Kandidat: Andrew Yang will 2020 der nächste US-Präsident werden. Sein aktuelles Buch ist allerdings kein Werk des Aufbruchs, sondern stellt schonungslos klar: Es kommen harte Zeiten auf die Staaten zu. Damit Amerika wieder „great“ werden kann, braucht es tiefgreifende Veränderungen.
Das muss man Andrew Yang lassen: Leicht macht er es sich nicht. Während der aktuelle Amtsinhaber schon zu seinen Bewerbungszeiten vor allem (rechts)populären Unsinn und hehre Versprechen von sich gegeben hat und schon jetzt als der wohl schlechteste Präsident aller Zeiten gelten muss, könnte Yangs Claim auch lauten: Yes We Can't. Nichts läuft gut im Staate Amerika, zählt er auf:
We are getting older.
We don't have adequate retirement savings.
We are financially insecure.
We use a lot of drugs.
We are not starting new businesses.
We are depressed.
We owe a lot of money public and private.
Our education system underperforms.
Our economy is consolidating around a few mega powerful firms in our most important industries.
Our media is fragmented.
Our social capital is lower.
We don't trust institutions any more.
Was das bedeutet, breitet er – Kind taiwanesischer Einwanderer, zu Schulzeiten gemobbt, als serieller Unternehmer zu Wohlstand gelangt – in seinem neuen Buch aus. Es trägt den etwas unglücklichen Titel „The War On Normal People“: Wer hier Krieg führt gegen den kleinen Mann, das lässt sich nicht so genau sagen. Konstatiert Yang selbst an einer Stelle:
„The challenges of job loss and technological unemployment are among the most significant faced by our society in history. They are even more daunting than any external enemy because both the enemy and the victim are hard to identify.“
Denn diese Herausforderungen seien Teil des unaufhaltsamen technischen Fortschritts – also von etwas eigentlich erst einmal Gutem. Müsse irgendwo ein Werk schließen, träfe das Angehörige, insgesamt aber herrsche der Konsens: Ist eben nicht mehr zeitgemäß, so Yang. Eine Illusion. Seinen Freunden an den Küsten habe er, der sich oft in Rust-Belt-Städten wie Detroit oder Cleveland beruflich aufhielt, gar nicht vermitteln können, wie tiefgreifend die Umwälzungen sind. Und traf es bislang vor allem diese klassischen Industriestädte, die klassischen Branchen, so steht nun die beschleunigte Automatisierung praktisch aller Branchen vor der Tür. Beispiel: Automaten bauen nicht nur Trucks, sie fahren sie in Zukunft auch. In derzeit 29 US-Staaten ist LKW-Fahrer der am meisten ausgeübte Beruf, wird aber auf kurz oder lang den sich selbst fahrenden Fahrzeugen zum Opfer fallen. Und so gehe es von Branche zu Branche weiter, dekliniert Yang durch, der progress macht die menschliche Arbeitskraft zusehend unnötig. „An automation wave is coming“, so Yang, und mit ihr einher werden Proteste, Kämpfe und Unruhen gehen, in einem auf ziviler Ebene bis an die Zähne bewaffneten Land. Zu erwartende Rassenunruhen würden zum Stellvertreterkrieg für die ökonomische Hoffnungslosigkeit. Wenn das prosperierende Kalifornien nicht ganz blöd ist, macht es den Calexit.
Yang ist so etwas wie der Anti-Pinker. Sagt dieser, alles werde besser (bis aufs Klima), spricht Yang von einer „incoming tide“ und landesweiter Depression. Ein Freund, dem er das Manuskript zum Lesen gegeben hat, habe ihm als Buchtitel „We're fucked“ vorgeschlagen, schreibt er. Nicht vergessen: Er will Präsident werden.
Hat er nichts Gutes zu vermelden? Was ist sein Plan? Der kommt im zweiten Teil des Buchs: Yang schlägt eine „Freedom Dividend“ von 12.000 Dollar pro Jahr und US-Amerikaner vor, das ist sein Name für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Bezahlen ließe sie sich mit einer Vereinheitlichung und Erhöhung der Mehrwertsteuer, rechnet er vor. Und sie wäre die Basis für neue berufliche Perspektiven der vielen, die im Zuge der Automatisierung ihre Jobs verlieren werden. Die Amerikaner würden gebildeter, gesünder, innovativer. Lobbytätigkeiten nach dem Staatsdienst will er unterbinden, das Ausbildungssystem erneuern – nicht mehr „high school readiness“, sondern die Ermächtigung der Generation Z zu einem guten Leben und zu handwerklichen Skills (für Dinge, die Maschinen nicht können). Und mit „social credits“ will er den Kommunitarismus 2.0 anschieben: Wer hilft, bekommt eine Vergütung.
Große Rhetorik ist seine Sache nicht, hier denkt und schreibt ein Pragmatiker. Nur selten erschallen Schlachtrufe wie sein progressives „Humanity first“ statt des Trump'schen „America first“. Nicht der Kapitalismus verändere Dinge, sondern der Mensch, sein Charakter, seine Empathie. Noch sei eine bessere Welt möglich, schließt Yang, als wolle er sich und uns nach Lektüre seiner düsteren Prognosen Mut machen. Ob er als Präsident dazu etwas wird beitragen können, gilt als wenig wahrscheinlich. Andere Kandidaten der Demokraten haben bessere Aussichten, aufgestellt zu werden. Aber was sagen Wahrscheinlichkeiten heute schon noch darüber aus, wer am Ende vereidigt wird.
Andrew Yang, The War on Normal People: The Truth About America's Disappearing Jobs and Why Universal Basic Income Is Our Future, ist bei Hachette Books erschienen und hat 304 Seiten. Mehr Infos hier. Einen Auszug des Buchs gibt es bei Medium.











